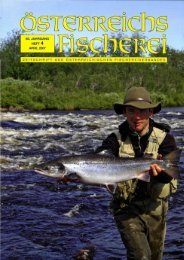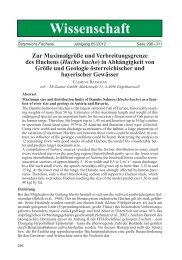Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
159<br />
senkung des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels in <strong>der</strong> Austufe zusätzlich beschleunigt. Dadurch gingen<br />
wichtige Lebensräume für manche Arten (z. B. stagnophile Fische wie Rotfe<strong>der</strong>,<br />
Schleie, Schlammpeitzger), Laichhabit<strong>at</strong>e für Krautlaicher (z. B. Hecht), <strong>und</strong> Refugialhabit<strong>at</strong>e<br />
für die <strong>Fischfauna</strong> (Hochwasser- <strong>und</strong> Wintereinstände) verloren.<br />
Durchströmte Nebenarme gingen vollständig verloren, sodass die nutzbare Gewässerfläche<br />
bzw. Uferlänge auch rheophiler Arten deutlich zurückging. Im entstandenen Regulierungsprofil<br />
weichen das Gefälle bzw. die Fließgeschwindigkeiten, die Substr<strong>at</strong>ausst<strong>at</strong>tung,<br />
Uferneigung sowie generell die Qualität <strong>und</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Uferzonen massiv vom<br />
Referenzzustand ab.<br />
In thermischer Hinsicht stellten sich durch den beschleunigten bzw. konzentrierten Abfluss,<br />
die verringerte Oberfläche (Erwärmung durch Einstrahlung <strong>und</strong> Temper<strong>at</strong>uraustausch)<br />
<strong>und</strong> den eingeschränkten Austausch mit dem Gr<strong>und</strong>wasser deutlich kühlere <strong>und</strong><br />
zeitlich-räumlich homogenere Verhältnisse ein, sodass gerade Arten mit höheren thermischen<br />
Ansprüchen ungünstigere o<strong>der</strong> gar ungeeignete Verhältnisse vorfanden. In diesem<br />
Zusammenhang vermuten KAINZ & GOLLMANN (2009), dass sich im unregulierten<br />
Oberlauf zur Zeit <strong>der</strong> großen Überschwemmungen im Frühjahr das Wasser auf den überschwemmten<br />
Arealen stärker erwärmt h<strong>at</strong>, sodass die für ein erfolgreiches Ablaichen von<br />
Arten mit höheren thermischen Ansprüchen erfor<strong>der</strong>lichen hohen Frühjahrstemper<strong>at</strong>uren<br />
erreicht wurden. Durch die regulierungsbedingte Rhithralisierung wurden diese Temper<strong>at</strong>uren<br />
nicht mehr erreicht, was einer <strong>der</strong> Gründe für das Verschwinden dieser Arten<br />
gewesen sein soll.<br />
In Summe bewirkte die verän<strong>der</strong>te Habit<strong>at</strong>ausst<strong>at</strong>tung eine Rhithralisierung. Zwar nahmen<br />
auch die Bestände rhithraler Arten (z. B. Bachforelle, Äsche) deutlich ab, überproportional<br />
waren aber die Bestände potamaler Arten von einem quantit<strong>at</strong>iven Einbruch<br />
gezeichnet.<br />
4.2.1.2. Wasserkraftnutzung<br />
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.<strong>at</strong><br />
Kontinuumsunterbrechungen<br />
So gut wie alle Flussfischarten führen zu unterschiedlichen Zeiten Wan<strong>der</strong>bewegungen<br />
sowohl in longitudinaler (flussauf, flussab) als auch in l<strong>at</strong>eraler Richtung (z. B. vom<br />
Hauptstrom in die Altwasser) durch, beispielsweise Laich- <strong>und</strong> Laichrückwan<strong>der</strong>ungen,<br />
Wan<strong>der</strong>ungen in Winterhabit<strong>at</strong>e o<strong>der</strong> Besiedelung von geeigneten Teilhabit<strong>at</strong>en unterschiedlicher<br />
Lebensstadien. Entsprechend <strong>der</strong> zurückgelegten Distanz werden Kurz-<br />
(max. wenige Kilometer, z. B. Bachforelle), Mittel- (einige 100 km, z. B. Nase, Barbe)<br />
<strong>und</strong> Langdistanzwan<strong>der</strong>er (einige 1000 km, z. B. Hausen) unterschieden (JUNGWIRTH et<br />
al. 2003).<br />
Wie essentiell ein Erhalt des Fließkontinuums für die Wan<strong>der</strong>ung von Flussfischarten im<br />
Gewässersystem <strong>der</strong> Oberen Donau ist, wurde bereits von STEINMANN et al. (1937) in<br />
den 1930er Jahren eingehend untersucht. Bei einer Reihe von Arten wurden sehr lange<br />
flussauf- <strong>und</strong> flussabwärts gerichtete Wan<strong>der</strong>ungen belegt, beispielsweise bei <strong>der</strong> Barbe<br />
im Einzelfall mehr als 300 km. Auch bei Nasen, Nerflingen <strong>und</strong> Aiteln wurden Wan<strong>der</strong>ungen<br />
von über 100 km nachgewiesen.<br />
Staudämme <strong>und</strong> Wehranlagen stellen Querverbauungen dar, welche das Fließkontinuum