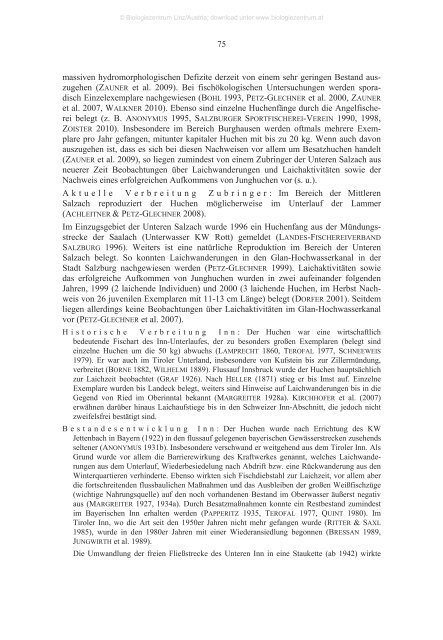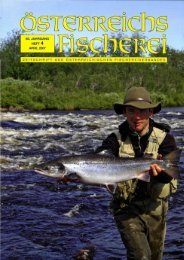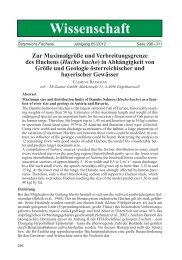Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach ... - Ratschan.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.<strong>at</strong><br />
75<br />
massiven hydromorphologischen Defizite <strong>der</strong>zeit von einem sehr geringen Bestand auszugehen<br />
(ZAUNER et al. 2009). Bei fischökologischen Untersuchungen werden sporadisch<br />
Einzelexemplare nachgewiesen (BOHL 1993, PETZ-GLECHNER et al. 2000, ZAUNER<br />
et al. 2007, WALKNER 2010). Ebenso sind einzelne Huchenfänge durch die Angelfischerei<br />
belegt (z. B. ANONYMUS 1995, SALZBURGER SPORTFISCHEREI-VEREIN 1990, 1998,<br />
ZOISTER 2010). Insbeson<strong>der</strong>e im Bereich Burghausen werden oftmals mehrere Exemplare<br />
pro Jahr gefangen, mitunter kapitaler Huchen mit bis zu 20 kg. Wenn auch davon<br />
auszugehen ist, dass es sich bei diesen Nachweisen vor allem um Bes<strong>at</strong>zhuchen handelt<br />
(ZAUNER et al. 2009), so liegen zumindest von einem Zubringer <strong>der</strong> Unteren <strong>Salzach</strong> aus<br />
neuerer Zeit Beobachtungen über Laichwan<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> Laichaktivitäten sowie <strong>der</strong><br />
Nachweis eines erfolgreichen Aufkommens von Junghuchen vor (s. u.).<br />
Aktuelle Verbreitung Zubringer: Im Bereich <strong>der</strong> Mittleren<br />
<strong>Salzach</strong> reproduziert <strong>der</strong> Huchen möglicherweise im Unterlauf <strong>der</strong> Lammer<br />
(ACHLEITNER & PETZ-GLECHNER 2008).<br />
Im Einzugsgebiet <strong>der</strong> Unteren <strong>Salzach</strong> wurde 1996 ein Huchenfang aus <strong>der</strong> Mündungsstrecke<br />
<strong>der</strong> Saalach (Unterwasser KW Rott) gemeldet (LANDES-FISCHEREIVERBAND<br />
SALZBURG 1996). Weiters ist eine n<strong>at</strong>ürliche Reproduktion im Bereich <strong>der</strong> Unteren<br />
<strong>Salzach</strong> belegt. So konnten Laichwan<strong>der</strong>ungen in den Glan-Hochwasserkanal in <strong>der</strong><br />
Stadt Salzburg nachgewiesen werden (PETZ-GLECHNER 1999). Laichaktivitäten sowie<br />
das erfolgreiche Aufkommen von Junghuchen wurden in zwei aufeinan<strong>der</strong> folgenden<br />
Jahren, 1999 (2 laichende Individuen) <strong>und</strong> 2000 (3 laichende Huchen, im Herbst Nachweis<br />
von 26 juvenilen Exemplaren mit 11-13 cm Länge) belegt (DORFER 2001). Seitdem<br />
liegen allerdings keine Beobachtungen über Laichaktivitäten im Glan-Hochwasserkanal<br />
vor (PETZ-GLECHNER et al. 2007).<br />
Historische Verbreitung Inn: Der Huchen war eine wirtschaftlich<br />
bedeutende Fischart des Inn-Unterlaufes, <strong>der</strong> zu beson<strong>der</strong>s großen Exemplaren (belegt sind<br />
einzelne Huchen um die 50 kg) abwuchs (LAMPRECHT 1860, TEROFAL 1977, SCHNEEWEIS<br />
1979). Er war auch im Tiroler Unterland, insbeson<strong>der</strong>e von Kufstein bis zur Zillermündung,<br />
verbreitet (BORNE 1882, WILHELMI 1889). Flussauf Innsbruck wurde <strong>der</strong> Huchen hauptsächlich<br />
zur Laichzeit beobachtet (GRAF 1926). Nach HELLER (1871) stieg er bis Imst auf. Einzelne<br />
Exemplare wurden bis Landeck belegt, weiters sind Hinweise auf Laichwan<strong>der</strong>ungen bis in die<br />
Gegend von Ried im Oberinntal bekannt (MARGREITER 1928a). KIRCHHOFER et al. (2007)<br />
erwähnen darüber hinaus Laichaufstiege bis in den Schweizer Inn-Abschnitt, die jedoch nicht<br />
zweifelsfrei bestätigt sind.<br />
Bestandesentwicklung Inn: Der Huchen wurde nach Errichtung des KW<br />
Jettenbach in Bayern (1922) in den flussauf gelegenen bayerischen Gewässerstrecken zusehends<br />
seltener (ANONYMUS 1931b). Insbeson<strong>der</strong>e verschwand er weitgehend aus dem Tiroler Inn. Als<br />
Gr<strong>und</strong> wurde vor allem die Barrierewirkung des Kraftwerkes genannt, welches Laichwan<strong>der</strong>ungen<br />
aus dem Unterlauf, Wie<strong>der</strong>besiedelung nach Abdrift bzw. eine Rückwan<strong>der</strong>ung aus den<br />
Winterquartieren verhin<strong>der</strong>te. Ebenso wirkten sich Fischdiebstahl zur Laichzeit, vor allem aber<br />
die fortschreitenden flussbaulichen Maßnahmen <strong>und</strong> das Ausbleiben <strong>der</strong> großen Weißfischzüge<br />
(wichtige Nahrungsquelle) auf den noch vorhandenen Bestand im Oberwasser äußerst neg<strong>at</strong>iv<br />
aus (MARGREITER 1927, 1934a). Durch Bes<strong>at</strong>zmaßnahmen konnte ein Restbestand zumindest<br />
im Bayerischen Inn erhalten werden (PAPPERITZ 1935, TEROFAL 1977, QUINT 1980). Im<br />
Tiroler Inn, wo die Art seit den 1950er Jahren nicht mehr gefangen wurde (RITTER & SAXL<br />
1985), wurde in den 1980er Jahren mit einer Wie<strong>der</strong>ansiedlung begonnen (BRESSAN 1989,<br />
JUNGWIRTH et al. 1989).<br />
<strong>Die</strong> Umwandlung <strong>der</strong> freien Fließstrecke des Unteren Inn in eine Staukette (ab 1942) wirkte