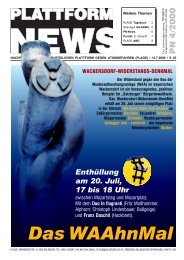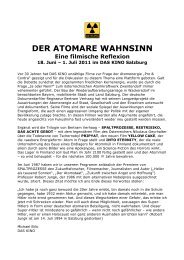Diplomarbeit zu Temelin & Melker Prozess - Plage
Diplomarbeit zu Temelin & Melker Prozess - Plage
Diplomarbeit zu Temelin & Melker Prozess - Plage
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hatte damals schon ihren Kurs festgelegt. SPÖ und ÖVP wollten ihre Ablehnung nur<br />
auf Rüthi beschränkt wissen (Schaller 1987, 164). Im Herbst 1973 bezeichnete<br />
Außenminister Kirchschläger Rüthi als einziges bilaterales Problem, und behielt sich<br />
internationale Schritte gegen das geplante KKW vor.<br />
Die Vorarlberger waren jedoch – wie Umfrageergebnisse zeigten – generell gegen die<br />
Nut<strong>zu</strong>ng der Kernenergie und im Speziellen gegen Rüthi. Im Oktober 1976 war es dann<br />
soweit: das Projekt Rüthi wurde von der Schweizer Regierung auf unbestimmte Zeit<br />
verschoben. Dies ging mit dem Rückgang des Energiebedarfs nach 1975 und dem<br />
<strong>zu</strong>nehmenden Druck des Widerstandes einher. Auch hatte sich <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt die<br />
internationale Kernenergiekontroverse verstärkt, so dass all diese Faktoren <strong>zu</strong> einem<br />
Aus für Rüthi führten.<br />
Es gab auch in Österreich Pläne für den Bau von Kernkraftwerken. Während sich<br />
Zwentendorf schon im Bau befand, einigte man sich auf einen zweiten Standort für ein<br />
KKW in Österreich: St. Pantaleon in Oberösterreich.<br />
1971 wurde St. Pantaleon als zweiter Standort erstmals diskutiert. Als die Entscheidung<br />
definitiv für den „(…) ohnehin schon industriell stark belasteten Raum (…)“ (Schaller<br />
1987, 179) fiel, regte sich auf lokaler Ebene bald Widerstand. Im April 1974 formierte<br />
sich die überparteiliche „Bürgerinitiative gegen Atomgefahren“ (BIAG) deren Ziel es<br />
war die Bevölkerung für das Thema <strong>zu</strong> mobilisieren. Die BIAG strebte ein<br />
Volksbegehren gegen das KKW an. Ein derartiges Volksbegehren war bereits 1969<br />
vom Verein „Gesundes Leben“ eingeleitet worden und wurde durch die BIAG<br />
fortgeführt. Die BIAG setzte sich vor allem aus Aktivisten des Österreichischen<br />
Naturschutzbundes <strong>zu</strong>sammen. Die Führungsposition wurden meist von FPÖ nahen<br />
Personen besetzt, später kam – organisatorisch unabhängig – der „Arbeitskreis<br />
Atomenergie Linz“ hin<strong>zu</strong>, welcher vom Kommunistischen Bund (KB) geprägt war. Der<br />
Widerstand wies also ein breites politisches Spektrum auf. Die Bevölkerung in St.<br />
Pantaleon war in Umweltfragen soweit sensibilisiert, dass die Gegner mit der<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ng der Bürger rechnen konnten. In Folge organisierte die BIAG<br />
Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen, die auf die Gefährdung durch Radioaktivität<br />
und die einseitige Informationspolitik der staatlichen Behörden und der EVUs<br />
hinwiesen. Bis Ende 1974 wurden knapp 100.000 Unterschriften gesammelt.<br />
Die Einstellung der politischen Akteure <strong>zu</strong>m Thema Kernenergie war verhältnismäßig<br />
eindeutig, obwohl es innerhalb der Parteien immer wieder <strong>zu</strong> Meinungsverschieden-<br />
15