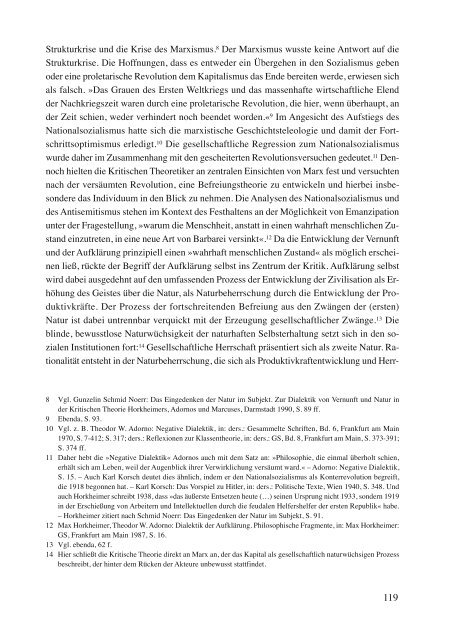Kritische Theorie der Krise - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritische Theorie der Krise - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritische Theorie der Krise - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Strukturkrise und die <strong>Krise</strong> des Marxismus. 8 Der Marxismus wusste keine Antwort auf die<br />
Strukturkrise. Die Hoffnungen, dass es entwe<strong>der</strong> ein Übergehen in den Sozialismus geben<br />
o<strong>der</strong> eine proletarische Revolution dem Kapitalismus das Ende bereiten werde, erwiesen sich<br />
als falsch. »Das Grauen des Ersten Weltkriegs und das massenhafte wirtschaftliche Elend<br />
<strong>der</strong> Nachkriegszeit waren durch eine proletarische Revolution, die hier, wenn überhaupt, an<br />
<strong>der</strong> Zeit schien, we<strong>der</strong> verhin<strong>der</strong>t noch beendet worden.« 9 Im Angesicht des Aufstiegs des<br />
Nationalsozialismus hatte sich die marxistische Geschichtsteleologie und damit <strong>der</strong> Fortschrittsoptimismus<br />
erledigt. 10 Die gesellschaftliche Regression zum Nationalsozialismus<br />
wurde daher im Zusammenhang mit den gescheiterten Revolutionsversuchen gedeutet. 11 Dennoch<br />
hielten die <strong>Kritische</strong>n Theoretiker an zentralen Einsichten von Marx fest und versuchten<br />
nach <strong>der</strong> versäumten Revolution, eine Befreiungstheorie zu entwickeln und hierbei insbeson<strong>der</strong>e<br />
das Individuum in den Blick zu nehmen. Die Analysen des Nationalsozialismus und<br />
des Antisemitismus stehen im Kontext des Festhaltens an <strong>der</strong> Möglichkeit von Emanzipation<br />
unter <strong>der</strong> Fragestellung, »warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand<br />
einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt«. 12 Da die Entwicklung <strong>der</strong> Vernunft<br />
und <strong>der</strong> Aufklärung prinzipiell einen »wahrhaft menschlichen Zustand« als möglich erscheinen<br />
ließ, rückte <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Aufklärung selbst ins Zentrum <strong>der</strong> Kritik. Aufklärung selbst<br />
wird dabei ausgedehnt auf den umfassenden Prozess <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Zivilisation als Erhöhung<br />
des Geistes über die Natur, als Naturbeherrschung durch die Entwicklung <strong>der</strong> Produktivkräfte.<br />
Der Prozess <strong>der</strong> fortschreitenden Befreiung aus den Zwängen <strong>der</strong> (ersten)<br />
Natur ist dabei untrennbar verquickt mit <strong>der</strong> Erzeugung gesellschaftlicher Zwänge. 13 Die<br />
blinde, bewusstlose Naturwüchsigkeit <strong>der</strong> naturhaften Selbsterhaltung setzt sich in den sozialen<br />
Institutionen fort: 14 Gesellschaftliche Herrschaft präsentiert sich als zweite Natur. Rationalität<br />
entsteht in <strong>der</strong> Naturbeherrschung, die sich als Produktivkraftentwicklung und Herr-<br />
8 Vgl. Gunzelin Schmid Noerr: Das Eingedenken <strong>der</strong> Natur im Subjekt. Zur Dialektik von Vernunft und Natur in<br />
<strong>der</strong> <strong>Kritische</strong>n <strong>Theorie</strong> Horkheimers, Adornos und Marcuses, Darmstadt 1990, S. 89 ff.<br />
9 Ebenda, S. 93.<br />
10 Vgl. z. B. Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, in: <strong>der</strong>s.: Gesammelte Schriften, Bd. 6, Frankfurt am Main<br />
1970, S. 7-412; S. 317; <strong>der</strong>s.: Reflexionen zur Klassentheorie, in: <strong>der</strong>s.: GS, Bd. 8, Frankfurt am Main, S. 373-391;<br />
S. 374 ff.<br />
11 Daher hebt die »Negative Dialektik« Adornos auch mit dem Satz an: »Philosophie, die einmal überholt schien,<br />
erhält sich am Leben, weil <strong>der</strong> Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward.« – Adorno: Negative Dialektik,<br />
S. 15. – Auch Karl Korsch deutet dies ähnlich, indem er den Nationalsozialismus als Konterrevolution begreift,<br />
die 1918 begonnen hat. – Karl Korsch: Das Vorspiel zu Hitler, in: <strong>der</strong>s.: Politische Texte, Wien 1940, S. 348. Und<br />
auch Horkheimer schreibt 1938, dass »das äußerste Entsetzen heute (…) seinen Ursprung nicht 1933, son<strong>der</strong>n 1919<br />
in <strong>der</strong> Erschießung von Arbeitern und Intellektuellen durch die feudalen Helfershelfer <strong>der</strong> ersten Republik« habe.<br />
– Horkheimer zitiert nach Schmid Noerr: Das Eingedenken <strong>der</strong> Natur im Subjekt, S. 91.<br />
12 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik <strong>der</strong> Aufklärung. Philosophische Fragmente, in: Max Horkheimer:<br />
GS, Frankfurt am Main 1987, S. 16.<br />
13 Vgl. ebenda, 62 f.<br />
14 Hier schließt die <strong>Kritische</strong> <strong>Theorie</strong> direkt an Marx an, <strong>der</strong> das Kapital als gesellschaftlich naturwüchsigen Prozess<br />
beschreibt, <strong>der</strong> hinter dem Rücken <strong>der</strong> Akteure unbewusst stattfindet.<br />
119