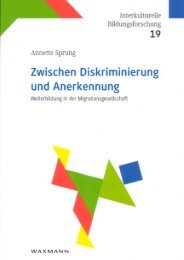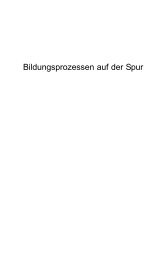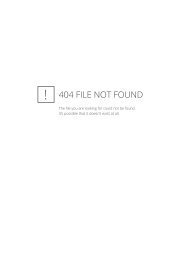eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Literaritätspraxis hierzulande – <strong>eine</strong> (sehr) kl<strong>eine</strong> Auswahl<br />
Allen erwähnten Komponisten gemeinsam ist ihre Bereitschaft, sich mit allen Arten <strong>der</strong><br />
Musik und <strong>eine</strong>r Vielfalt musikalischer Kanons zu befassen – von <strong>der</strong> Klassik über den<br />
Neo-Klassizismus und die Neo-Romantik, mit allen Formen zeitgenössischer Musik, <strong>der</strong><br />
Avantgarde einschließlich elektronischer Musik sowie mit populären Musikformen. Sie nahmen,<br />
wie Ligeti es nennt, die Denkweisen z.B. <strong>der</strong> elektronischen Musik auf, auch wenn<br />
sie sich für an<strong>der</strong>e Kompositionstechniken entschieden. Sie wollen das Klangspektrum erweitern<br />
und erneuern und auch gezielt die Grenzen zwischen ernster und unterhalten<strong>der</strong> Musikdarbietung<br />
und Musikrezeption verschieben. Ligeti, Cerha und Schwertsik gaben ihr Wissen<br />
auch als Lehrer für Komposition, Notation und Interpretation an internationalen Universitäten<br />
weiter, so auch an <strong>der</strong> Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.<br />
Sprachidiom <strong>der</strong> Musik und Klangidiom <strong>der</strong> Sprache<br />
Eine weitere Gemeinsamkeit dieser zeitgenössischen Komponisten besteht in ihrer Beziehung<br />
zur Sprache, zur gesprochenen wie zur geschriebenen Sprache und ihrer Literatur.<br />
Sie interessierten sich für Klang, Rhythmus, Tempo, Modulation und Intonation <strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Alltagskommunikation verwendeten Sprache, für ihre rhetorischen und dialogischen Mittel<br />
und die dadurch erzielten Effekte, um damit auch das <strong>Frage</strong>n stellen, Rede und Gegenrede,<br />
Lakonik, Doppelbödigkeit, Ironie und den Humor im Klangspektrum <strong>der</strong> Musik durch das<br />
Kommunizieren von Instrumenten und Stimmen wie<strong>der</strong> erkennbar und so hörbar zu machen.<br />
Es ging ihnen bei <strong>der</strong> Titelgebung, beim Libretto, bei <strong>der</strong> Vokalmusik und bei Angaben zur<br />
Aufführung immer auch um Einbeziehung <strong>der</strong> semantischen und metaphorischen Komponenten<br />
<strong>der</strong> Sprache, um <strong>eine</strong> bewusst gewählte eigenwillige Orthografie, auch Sprachen<br />
mischend, und um Interpunktion. Sie bedienten sich sprachlich <strong>der</strong> Technik des Zitierens<br />
und des Verweisens auf Vorlagen und Vorbil<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Literatur, auch <strong>der</strong> musikalischen.<br />
Es war ihnen wichtig, mit unterschiedlichen sprachlichen Registern und Genres zu spielen<br />
und auch mit ihrer Wirkung als „Botschaft“ für ein Publikum, das zugleich „s<strong>eine</strong>r Zeit“<br />
und ihren öffentlichen Redefiguren zuhört und doch mit dem Klanggedächtnis auch noch<br />
mit <strong>der</strong> Zeit davor verbunden ist.<br />
In den 1950er Jahren gab es zeitweise <strong>eine</strong> direkte Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> literarischen<br />
Gruppierung <strong>der</strong> Wiener Gruppe. Beide, Musik und Literatur, beschäftigten sich damals mit<br />
dem eigenständigen Materialcharakter <strong>der</strong> Sprache und mit <strong>der</strong> Exploration <strong>der</strong> akustischen<br />
Wirkungen ihrer Rede- und Klanggestalt. Eine weitere Gemeinsamkeit ist <strong>der</strong> Brückenschlag<br />
zwischen <strong>eine</strong>r barocken Sprachtradition, auch mit den Mitteln des Derben und Zotigen<br />
als Ausdruck <strong>eine</strong>r Sprachkritik „von unten“, und <strong>der</strong> sprachkritischen Tradition etwa bei<br />
Nestroy, Kraus o<strong>der</strong> Offenbach, und den surrealistischen Techniken <strong>der</strong> Demontage und<br />
Montage von Sinn, Hintersinn, Unsinn anhand von sprachlichen Klang- und Kompositionselementen,<br />
wie etwa bei Kurt Schwitters’ Ursonate. Auch das wienerische Sprachidiom, s<strong>eine</strong><br />
Melodik, s<strong>eine</strong> Klangfarben und Lautungsvariationen werden zu <strong>eine</strong>r wichtigen Quelle <strong>der</strong><br />
musikalischen Klangsprache.<br />
Erweiterte Klangräume und Rezeptionsweisen<br />
Ein relativ junges Phänomen <strong>der</strong> Stadt – und das gilt nicht nur für Wien – ist <strong>der</strong> breite<br />
Klangteppich an täglicher Live-Musik vom Jazz über Ethnomusik, Funk, Indie und Techno<br />
in <strong>eine</strong>r Fülle von unterschiedlichen Veranstaltungsorten, vom Konzertsaal, über Oper, Cafés,<br />
Gasthäuser, Clubs, Museen, Discos. MusikerInnen und Musikgruppen aus aller Welt und<br />
aus allen Stilrichtungen kommen (auch) nach Wien. Neben Kulturinitiativen auf Bezirks-<br />
117