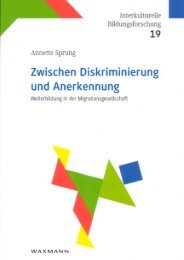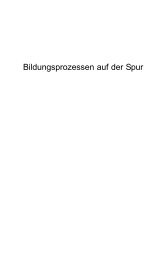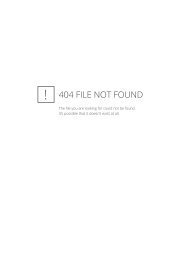eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
60 Literaritäten im Kontext<br />
Pädagogen Paolo Freire. Er betrachtet die praktischen Anliegen und Lebensverhältnisse<br />
<strong>der</strong> – wie er sie nennt – erwachsenen „Schüler“ als Ausgangspunkt für Bildung und als<br />
Bezugspunkt für die jeweiligen Unterrichtsformen. Als Ziel von Bildung und Bildungsarbeit<br />
bezeichnet er die För<strong>der</strong>ung von Autonomie und das Entdecken von Handlungsperspektiven<br />
in realen Problemsituationen, die wichtigsten Instrumente dafür sind s<strong>eine</strong>s Erachtens Reflexion<br />
und Dialog. Daraus entwickelte Freire ein gemeindenahes Modell <strong>der</strong> Alphabetisierung,<br />
in dem die Instrumente <strong>der</strong> Sprache und <strong>der</strong> Schrift aus dem gemeinsamen Gespräch und<br />
dank <strong>der</strong> Erfahrung und des Wissens <strong>der</strong> beteiligten Erwachsenen über die praktischen<br />
Lebenszusammenhänge und für konkrete Anliegen erarbeitet und ausgebaut werden. Dieser<br />
Arbeits- und Denkansatz des partizipativen Lernens von Erwachsenen für die eigenen Lebensumstände<br />
gewinnt an <strong>der</strong> Wende vom 20. zum 21. Jahrhun<strong>der</strong>t zunehmend an Aktualität.<br />
Die Bedingungen und Möglichkeiten aktiver gesellschaftlicher Beteiligung und Teilhabe aller<br />
Menschen auf allen Ebenen entwickeln sich heute zu <strong>eine</strong>m demokratiepolitischen Kernthema<br />
und werden häufig als Kriterium <strong>eine</strong>r nachhaltigen Entwicklung betrachtet.<br />
Der zweite wichtige Entwicklungsstrang entsteht genuin aus <strong>der</strong> intensiven Beschäftigung<br />
mit Gesundheit, Gesundheitsverständnis und Gesundheitsbildung in den 1980er Jahren.<br />
Angesichts beträchtlicher Strukturprobleme im Gesundheitssektor kommen Impulse für diese<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung von basisdemokratischen, bürgerrechtlichen Gesundheitsinitiativen und<br />
aus <strong>der</strong> Reflexion über die Ausrichtung und Wirksamkeit regionaler und nationaler gesundheitspolitischer<br />
Kampagnen. Diese Auseinan<strong>der</strong>setzung führte 1987 in Ottawa zur Neuformu -<br />
lierung des Gesundheitsbegriffes durch die Weltgesundheitsorganisation. Die wesentlichen<br />
Punkte dieser Neukonzeption sind: Gesundheit wird verstärkt als <strong>eine</strong> soziale und rechtliche<br />
Konstellation und Kondition für Menschen definiert. Sie umfasst das körperliche, soziale<br />
und mentale Wohlbefinden und ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit<br />
bezeichnet ebenso das persönliche und soziale Umfeld wie individuelle Fähigkeiten und<br />
Verhaltensweisen. Sie ist kein Lebensziel, son<strong>der</strong>n alltägliche Lebensgrundlage. Sie entsteht<br />
und hat überall dort Bedeutung, wo und wie auch immer Menschen arbeiten, lernen, lieben.<br />
Gesundheit zu för<strong>der</strong>n ist daher nicht ausschließlich die Angelegenheit <strong>eine</strong>s Bereichs, son<strong>der</strong>n<br />
<strong>eine</strong> Aufgabenstellung sowohl in jedem beson<strong>der</strong>en Lebenskontext als auch im öffentlichen<br />
Leben. För<strong>der</strong>lich für sie ist nur, was zur jeweiligen Praxis von Menschen und ihren<br />
Anliegen passt. Um diese zu verstehen, genügt es nicht, das Thema einfach aufzuwerfen,<br />
vielmehr ist ein gemeinsames Lernen aller Beteiligten nötig. Erst durch die gemeinsame<br />
praxisbezogene Auseinan<strong>der</strong>setzung verschiedener Beteiligter – aus den unterschiedlichen<br />
praktischen Zusammenhängen von Wissen und Erfahrung von Betroffenen, Laien, PraktikerInnen<br />
und TheoretikerInnen – ergeben sich konkrete und übertragbare Erkenntnisse über<br />
Bedingungen und Potentiale <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung. Gesundheit und Bildung verschränken und verän<strong>der</strong>n<br />
sich und einan<strong>der</strong> in Form und Wirkungsweise.<br />
Parallel dazu entwickelt sich ein sozialwissenschaftlich ausgerichteter partizipativer Forschungstyp,<br />
<strong>der</strong> in enger Kooperation mit NutzerInnen und Anbietern von Gesundheits -<br />
einrichtungen systematisch Aspekte <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung an Strukturen, Abläufen und<br />
<strong>der</strong> Kommunikationen im Gesundheitssektor untersucht. Von den vielen Beiträgen, die das<br />
österreichische Ludwig Boltzman-Institut für Health Promotion Research dazu geleistet hat,<br />
seien zwei exemplarische zur Gesundheitsför<strong>der</strong>ung durch Verbesserung von Beteiligung<br />
(Partizipation) und Teilhabe (Inklusion) zumindest genannt: „Das patientenfreundliche Spital“<br />
und das bereits an an<strong>der</strong>er Stelle behandelte Forschungsprojekt „Das migrantenfreundliche