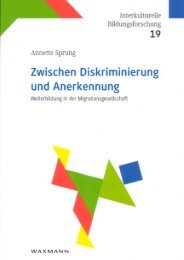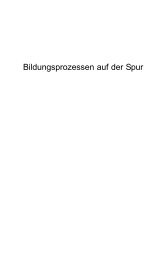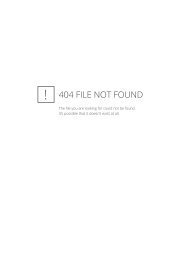eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
122 Literaritätspraxis hierzulande – <strong>eine</strong> (sehr) kl<strong>eine</strong> Auswahl<br />
Diese Einstellung macht ihn offen für neue Wege und Formen, Musik zu machen und sie<br />
<strong>eine</strong>m breiteren Publikum zu vermitteln. Und sensibilisiert ihn für die Schwierigkeiten, die<br />
StudentInnen aus an<strong>der</strong>en Kulturen bei <strong>der</strong> Begegnung mit <strong>eine</strong>r für sie neuen Kultur vorfinden.<br />
Deshalb plädiert er für die Entwicklung <strong>eine</strong>r „Kultur“ des kulturellen Austauschs<br />
auf allen universitären Ebenen. Der Kulturaustausch vollziehe sich nicht nur in <strong>eine</strong><br />
Richtung, die Universität habe auch von und durch ihre internationale StudentInnenschaft<br />
zu lernen – und das tue sie auch. Und wenn man zu Recht for<strong>der</strong>e, dass die StudentInnen<br />
Deutsch lernen, müsse es auch geeignete Angebote an <strong>der</strong> Universität geben.<br />
Kulturelle Schuhlöffelstrategien<br />
Deutlich verän<strong>der</strong>t, etwa im Vergleich zu vor 10 Jahren, hat sich die Vertrautheit <strong>der</strong> Studen -<br />
tInnen mit dem Werkekanon <strong>der</strong> europäischen Musiktradition. Die StudentInnen kennen<br />
Werke <strong>der</strong> europäischen Musikkultur, z.B. <strong>eine</strong> Symphonie von Dvorˇák, Beethoven o<strong>der</strong><br />
Schubert-Lie<strong>der</strong>, nicht mehr vom Hören. Es fehlt das einst weitgehend selbstverständlich<br />
vorhandene und auch vorausgesetzte Hörerlebnis einschlägiger Werke, und zwar sowohl bei<br />
„hiesigen“ als auch bei den internationalen MusikstudentInnen. Dies ist sicherlich zum <strong>eine</strong>n<br />
das Ergebnis <strong>der</strong> globalisierten Vielfalt und Verbreiterung des Musikangebots, zum an<strong>der</strong>en<br />
aber umfasst dieser Werkekanon <strong>eine</strong>n Zeitraum von mehr als 250 Jahren – und rückt für<br />
jede neue Generation noch weiter in die Vergangenheit. Der Unterricht kann also nicht mehr<br />
auf <strong>eine</strong>m gemeinsamen Fundament gesicherter Grundbaust<strong>eine</strong> aufbauen, sich etwa auf<br />
die Kenntnis des über Musik und Literatur zu Musik dokumentierten Dialogs zwischen den<br />
KomponistInnen und ihren Werken beziehen. Dieser Verlust verlangt nach Umstellung,<br />
bietet damit aber zugleich die Chance, „sich etwas Neues einfallen zu lassen“. Auf „Altes“,<br />
etwa auf die Spätklassik und Frühromantik zurückzugreifen, wird schwieriger. Umso wichtiger<br />
werde es, Brücken zu bauen zwischen damals und heute, meint Aichinger:<br />
„Es geht um die Entwicklung <strong>eine</strong>r exemplarischen Sensibilität für das kontextuelle<br />
Denken und Empfinden <strong>eine</strong>r Zeit, das die Studenten über die Resonanz in ihrem<br />
Erleben dazu ermutigt, <strong>eine</strong>n eigenständigen Weg <strong>der</strong> Erarbeitung und Übertragung<br />
<strong>eine</strong>s Werkes zu finden.“<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund je<strong>der</strong> musikalischen Vermittlung steht für Aichinger Begegnung und Dialog<br />
mit Kultur. Um diese anzuregen, entwickelt und verwendet er <strong>eine</strong> Reihe von sog. „Schuhlöffelstrategien“,<br />
wie er das nennt. So dient etwa ein historisch-literarischer Schuhlöffel<br />
dazu, die Zeit, die musikalischen und außermusikalischen Einflüsse, Stilelemente, Kompositionsvorlagen<br />
und -ideen von Beethoven o<strong>der</strong> Schubertstücken empathisch nachvollziehbar<br />
zu machen. Indem z.B.die StudentInnen eingeladen werden, die 7. Symphonie Beethovens, die<br />
kurz nach s<strong>eine</strong>m Brief An die unsterbliche Geliebte entstand, als <strong>eine</strong>n Sehnsuchtsgesang<br />
an <strong>eine</strong> ferne Geliebte aufzufassen und auf diese Weise die musikalische Form auf sich<br />
wirken zu lassen. O<strong>der</strong> indem Goethes Gedicht Der Erlkönig als exemplarisches Beispiel<br />
für <strong>eine</strong> spannungsgeladene Gestaltung tief empfundener und weit verbreiteter Ängste vor<br />
<strong>eine</strong>m übermächtigen In-Besitz-Genommen-Werden dient. Das Metrum, <strong>der</strong> Refrain und <strong>der</strong><br />
Beschwörungscharakter <strong>der</strong> Ballade wird zum Anlass dafür, rhythmische Elemente und<br />
Spannungsbögen im deutschen Volkslied als Basis des Kunstlieds bei Schubert und volksliedähnlicher<br />
Stilelemente in <strong>der</strong> Orchestermusik, <strong>der</strong>en Instrumentierung sowie Artikulation<br />
und Einsatz von Gesangs- und Instrumentenstimmen als musikalische Stilmittel <strong>der</strong> Erzählung<br />
zu entdecken.