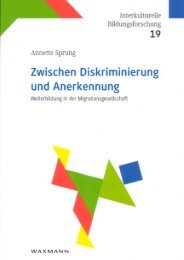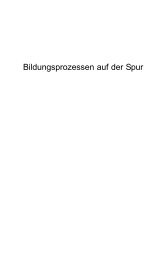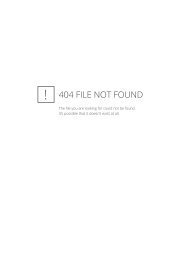eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
eine zentrale Frage der Wissensvermittlung (pdf)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einan<strong>der</strong> verbunden. Und historisch gehören sie in <strong>der</strong> Musikentwicklung zusammen. Der/die<br />
KomponistIn ist hellhörig für s<strong>eine</strong>/ihre Zeit, sammelt die Klangmaterialien, um sie in<br />
s<strong>eine</strong>r/ihrer Weise einzusetzen und zu verän<strong>der</strong>n. Für MusikerInnen ist jede Musik, festgehalten<br />
als Werk o<strong>der</strong> in Wie<strong>der</strong>gabe, Quelle und Material für weitere Bearbeitungen. So<br />
ist das Archiv Dokumentation vieler „flüchtiger“ Klänge und ermöglicht, die Stadt auch als<br />
Klangteppich o<strong>der</strong> Klanglandschaft zu erkennen. Sie wird hörbar und damit als soziokulturelle<br />
Quelle, auch an ihrer Musik, lesbar. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Quellenarbeit werden publiziert,<br />
das Material ist neben <strong>eine</strong>r Literatursammlung in <strong>eine</strong>r Bibliothek zugänglich. Aktuelle<br />
Projekte des Archivs sind etwa Stimmporträts, Musik im Alltag, Hauskonzerte, das inter -<br />
nationale Musikspektrum in Wien, traditionelle Wiener Musik, das Jazzleben in Wien o<strong>der</strong><br />
die Musik <strong>der</strong> Jüdischen Gemeinde in Wien.<br />
Musik als Dialogisieren mit ihren Quellen<br />
Um ein lebendiges und heutiges Musikverständnis geht es Nikolaus Harnoncourt mit s<strong>eine</strong>r<br />
seit 50 Jahren praktizierten historischen Quellenarbeit. Denn, so s<strong>eine</strong> Überzeugung, „Musik<br />
verän<strong>der</strong>t den Menschen, Hörer wie Musiker […]. Musik ist unverzichtbar, wenn wir [uns] und<br />
sie verstehen wollen.“ 31 Indem er die Zeit und den Kontext von Klangideen, Musizierformen,<br />
die Geschichte <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>eine</strong>s Werkes und von professionellen Aufführungspraktiken<br />
in den folgenden Zeiten als <strong>der</strong>en Interpretationen wie<strong>der</strong> zum Thema macht, versucht er,<br />
das Zeitlose von Musik im Sinne <strong>eine</strong>r über die Zeiten hinweg interessanten Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit den durch die Musik aufgeworfenen <strong>Frage</strong>n und Wi<strong>der</strong>sprüchen heute wie<strong>der</strong><br />
freizulegen und hörbar zu machen. Einem vermeintlich autoritativen Begriff <strong>der</strong> Authentizität<br />
und <strong>eine</strong>r „allgemeingültigen“ Wie<strong>der</strong>gabe setzt er s<strong>eine</strong> kritische Analyse von Literatur,<br />
Texten über Musik und Partituren entgegen. Und er zeigt anhand <strong>der</strong> Notation <strong>eine</strong>s<br />
Werkes, dass es auch in <strong>der</strong> Notenschrift, wie bei je<strong>der</strong> Sprache und jedem Text, eben bei<br />
je<strong>der</strong> Art von Schreiben, Vieldeutigkeit gibt. Und wie bei je<strong>der</strong> Art, <strong>eine</strong>n Text zu lesen,<br />
filtert jede/r LeserIn – und all jene, die Noten bearbeiten und drucken – durch s<strong>eine</strong>/ihre<br />
Vorstellungen über den Klang und die Zeit des Textes. Alle, die vergangene Werke spielen,<br />
müssen sich dessen bewusst sein und dieses Wissen für sich übersetzen. Dieses Wissen<br />
ist nur „entzifferbar“ im historischen Zusammenhang. Zwar galten bis ins 17. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
eindeutige Zeichen, aber auch sie wurden von den InterpretInnen immer an<strong>der</strong>s gelesen.<br />
Bis zum Ende des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts ist beim Aufführen <strong>eine</strong>s Werkes Improvisation, Verzierung<br />
des Werkes üblich. Ebenso wie Lesarten und Improvisationspraxis verän<strong>der</strong>n sich die<br />
Instrumente, die Klangvorstellung, die Spielweise und die Gesangstechnik.<br />
„Verhängnisvoll ist allerdings <strong>der</strong> noch immer weitverbreitete Irrtum, die Notenzeichen,<br />
die Affekt- und Tempoworte sowie die dynamischen Bezeichnungen hätten<br />
schon immer dieselbe Bedeutung gehabt wie heute. Diese irrige Ansicht wird durch<br />
die Tatsache geför<strong>der</strong>t, dass seit Jahrhun<strong>der</strong>ten beim Aufschreiben dieselben grafischen<br />
Zeichen verwendet werden, es wird zuwenig bedacht, dass die Notenschrift<br />
nicht einfach <strong>eine</strong> zeitlose, übernationale Bezeichnungsmethode für Musik ist, die<br />
für mehrere Jahrhun<strong>der</strong>te unverän<strong>der</strong>t gilt; mit den stilistischen Wandlungen <strong>der</strong><br />
Musik, den Ideen <strong>der</strong> Komponisten und <strong>der</strong> ausführenden Musiker verän<strong>der</strong>t sich<br />
auch die Bedeutung <strong>der</strong> verschiedenen Zeichen <strong>der</strong> Notenschrift.“ 32<br />
31 Ebd., S. 10.<br />
32 Ebd., S. 36.<br />
Literaritätspraxis hierzulande – <strong>eine</strong> (sehr) kl<strong>eine</strong> Auswahl<br />
119