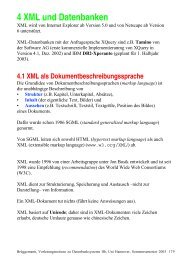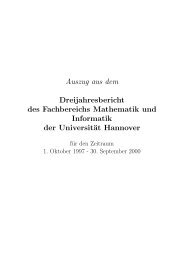Defaults in deduktiven Datenbanken
Defaults in deduktiven Datenbanken
Defaults in deduktiven Datenbanken
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.2. INTENDIERTE MODELLE 33Offene Frage 2.2.8: Kann man e<strong>in</strong>en geschlossenen Ausdruck für die Anzahl derkumulierenden und konsistenzerhaltenen Vervollständigungen angeben? Die gleiche Fragestellt sich natürlich auch für andere Komb<strong>in</strong>ationen von Eigenschaften aus Kapitel 4 oderRepräsentations-Formalismen aus Kapitel 5.Es ist im Pr<strong>in</strong>zip denkbar, solche Aufzählungsprogramme für den Entwurf von Vervollständigungendurch Beispiele e<strong>in</strong>zusetzen. Hat man etwa für e<strong>in</strong>ige AxiomenmengenΦ die <strong>in</strong>tendierten Modelle ausgezeichnet, und setzt man darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e gewisseStruktur der Vervollständigung voraus, so führt das zu e<strong>in</strong>er drastischen E<strong>in</strong>schränkungder möglichen Vervollständigungen. Betrachtet man etwa nur Vervollständigungen vomTyp m<strong>in</strong>imale Modelle“, so ist die obige Vervollständigung e<strong>in</strong>deutig durch die Angaben”der folgenden Beispiele bestimmt:Φ comp(Φ)∅ ¬p, ¬qp p, ¬qq q, ¬pp ∨ q p ∨ q, ¬p ∨ ¬qM<strong>in</strong>destens für besonders kritische Teile des Entwurfs, wo die verwendeten <strong>Defaults</strong> nichtoffensichtlich s<strong>in</strong>d, könnte e<strong>in</strong>e solche Vorgehensweise hilfreich se<strong>in</strong>. Sie ist also demWissenserwerb und dem masch<strong>in</strong>ellen Lernen zuzurechnen. Auch zur Überprüfung e<strong>in</strong>erVervollständigung, d.h. der Auswahl von Testfällen Φ, könnten solche Überlegungenbeitragen.Solche Auswahlfunktionen haben e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache mathematische Struktur und treten nichtnur bei Vervollständigungen auf. Insbesondere s<strong>in</strong>d sie schon <strong>in</strong> der Theorie der Wahlverfahren( social choice theory“) untersucht worden, e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Teilgebiet von”Mathematik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften [Mou85].Hier wird statt I Σ e<strong>in</strong>e beliebige Menge von möglichen Alternativen betrachtet. Dieskönnten etwa Personen se<strong>in</strong>, die für e<strong>in</strong> Amt <strong>in</strong> Frage kommen, oder Rechnermodelle,von denen e<strong>in</strong>es beschafft werden soll (es müssen ja ständig irgendwelche Entscheidungengetroffen werden).Zur Auswahl steht aber jeweils nicht die ganze Menge der möglichen Alternativen,sondern nur e<strong>in</strong>e Teilmenge. In den Beispielen wären das die Menge der Personen, dietatsächlich kandidieren, oder die Menge der Rechnermodelle, die unter e<strong>in</strong>er gewissenPreisgrenze liegen. Zu jeder solchen Kandidatenmenge bestimmt die Auswahlfunktionwieder e<strong>in</strong>e Teilmenge, nämlich die Alternativen, zu deren Gunsten die Entscheidungfällt. Da im allgeme<strong>in</strong>en nur e<strong>in</strong>e Alternative realisiert werden kann, muß bei Bedarf dasLos geworfen werden.Diese Theorie untersucht nun e<strong>in</strong>en speziellen Aspekt solcher Entscheidungsprozesse,nämlich die Abhängigkeit der Entscheidung von der Kandidatenmenge. So wäre es dochetwa unlogisch, wenn dadurch, daß e<strong>in</strong> Verlierer se<strong>in</strong>e Kandidatur zurückzieht, sich das