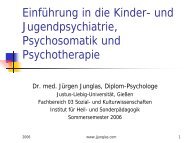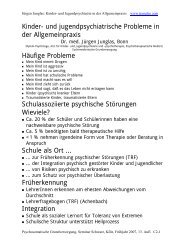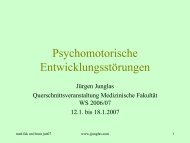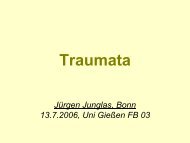Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
128<br />
<strong>Experimentelle</strong> <strong>Untersuchung</strong> <strong>von</strong> <strong>Versprechern</strong> <strong>bei</strong> <strong>Zwangspatienten</strong><br />
angemessen. Hamm und Bredenkamp (2004) berichten <strong>von</strong> <strong>Untersuchung</strong>en, die gezeigt<br />
haben, dass auch die Einhaltung eines konstanten Rhythmus kapazitätsbelastend ist und somit<br />
als Kontrollbedingung ausscheidet. Außerdem konnten sie belegen, dass nicht jede<br />
Zusatzaufgabe zu mehr Sprechfehlern führt.<br />
Betrachtet man den Befund der vorliegenden <strong>Untersuchung</strong> aus der Perspektive der<br />
postulierten notwendigen Bedingungen für Versprecher (Kap. 2.1.3), so kann man da<strong>von</strong><br />
ausgehen, dass Freuds (1901) Annahme bezüglich des Kompromisscharakters <strong>von</strong><br />
<strong>Versprechern</strong> darauf beruht, dass er eine vollständige Abwesenheit <strong>von</strong> Kontrollmechanismen<br />
für unwahrscheinlich hält, d.h. zum einen besteht für die Äußerung des ursprünglich<br />
Intendierten nicht genügend Kontrolle und zum anderen verhindert ein noch vorhandener<br />
kontrollierender Prozess das vollständige Durchsetzen der störenden Intention. Demnach<br />
könnten neben den verschiedenen Möglichkeiten zur Entstehung <strong>von</strong> <strong>Versprechern</strong> auch<br />
unterschiedliche Kontrollprozesse unterschieden werden, und zwar ein ‚bewusster’<br />
Kontrollprozess, der dafür verantwortlich ist, dass sich das ursprünglich Intendierte <strong>bei</strong> der<br />
Artikulation durchsetzt, sowie ein ‚unbewusster’ Kontrollprozess, der die Artikulation <strong>von</strong><br />
konflikthaftem Wortmaterial verhindert (vgl. Dilger & Bredenkamp, 2003).<br />
Die Konzeption eines aufmerksamkeitsgesteuerten präartikulatorischen Kontrollsystems fand<br />
sich bereits <strong>bei</strong> Meringer und Meyer (1895):<br />
„Man muss sich hüten, den Sprechfehler als etwas Pathologisches aufzufassen. Beim Sprechfehler<br />
versagt nur die Aufmerksamkeit, die Maschine läuft ohne Wächter, sich selbst überlassen.“<br />
Entsprechende Evidenz für einen solchen präartikulatorischen Kontrollprozess lieferten vor<br />
allem die Ar<strong>bei</strong>ten <strong>von</strong> Baars und Kollegen (für einen Überblick vgl. Baars, 1980; siehe auch<br />
Dilger und Bredenkamp, 1998). Diese Autoren haben die sogenannte SLIP-Technik<br />
entwickelt, die es erlaubt, phonologische Fehler im Labor zuverlässig zu induzieren (siehe<br />
2.3.1). Mit dieser Technik konnten sie einen lexikalen Bias-Effekt beobachten: Wenn durch<br />
die Lautvertauschung reale Wörter resultieren, finden sich in ca. 30% der Durchgänge<br />
entsprechende Fehler (Maul-Held). Im Gegensatz dazu finden sich nur 10%<br />
Vertauschungsfehler, wenn sich durch die Vertauschung Pseudowörter (Mauk-Hels) ergeben.<br />
Dieses Muster liefert Hinweise darauf, dass die Probanden ihre Äußerungen bezüglich<br />
lexikaler Korrektheit vor der Artikulation überprüfen, sofern die Aufgabe lexikales Material<br />
enthält. Fehler, <strong>bei</strong> denen Pseudowörter entstehen, werden anscheinend gut präartikulatorisch<br />
herausgefiltert.