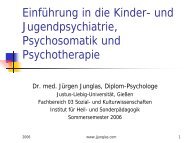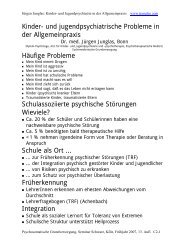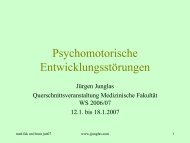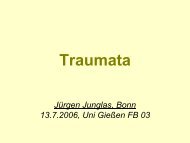Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
56<br />
<strong>Experimentelle</strong> <strong>Untersuchung</strong> <strong>von</strong> <strong>Versprechern</strong> <strong>bei</strong> <strong>Zwangspatienten</strong><br />
Motleys (1980) Versuche geben Hinweise darauf, dass nicht nur durch die Induktoren,<br />
sondern auch durch die Situation Gedanken angeregt werden, die zu Sprechfehlern führen.<br />
Insofern weisen diese Versuche eine Nähe zu Freud auf, der Sprechfehler als das Resultat<br />
eines Konflikts zwischen verschiedenen Intentionen ansieht. Besonders das dritte Experiment,<br />
das sich auf die persönlichen Aspekte der Probanden bezieht, sieht Motley als unmittelbare<br />
Bestätigung der Freudschen Fehlleistungstheorie. Auf die Frage, inwieweit sich die<br />
Fehlleistungen als Kompromiss darstellen, geht Motley nicht ein. Es erfolgt lediglich die<br />
Auswertung der Spoonerismen (störende Tendenz setzt sich durch; zumindest <strong>bei</strong> vollen<br />
Sponnerismen).<br />
2.5.3 Kritik <strong>von</strong> Grünbaum<br />
Adolf Grünbaum (1988) lobte in seinem Buch 'Die Grundlagen der Psychoanalyse: Eine<br />
philosophische Kritik' die <strong>Untersuchung</strong>en <strong>von</strong> Motley (1980) als raffiniert und phantasievoll,<br />
allerdings mit dem Einwand, dass keines der drei Experimente auch nur die Schwelle<br />
erreiche, wo man <strong>von</strong> einer Überprüfung der psychoanalytischen Theorie sprechen könne.<br />
Motleys erstes Experiment machte deutlich, dass ein durch die Interferenzwörter angeregter<br />
interferierender Gedanke kausalen Einfluss auf die Versprecherhäufigkeit ausübt. Neben der<br />
phonetisch bestimmten Tendenz zum Spoonerismus wurde auch eine semantisch bestimmte<br />
Tendenz im Sprecher erzeugt. Nach Grünbaum (1988, S. 332) stützt dieses Experiment<br />
lediglich die Freudsche These, dass Fehlleistungen sinnvoll seien und sie auf einer<br />
nachvollziehbaren Tendenz des Fehlleistenden beruhen. Die Einflüsse in diesem Experiment<br />
seien vorbewusst, „wenn nicht im Kern völlig bewusst“.<br />
Das zweite Experiment war so angelegt, dass die störenden Gedanken als 'zurückgedrängt'<br />
verstanden werden könnten. Für den „Elektroschock-Gedanken“ galt dies wegen der<br />
offenbaren Angstbesetzung. Auch die erotischen Gedanken waren für einen Teil der<br />
Versuchspersonen angstbesetzt. Dennoch können diese Bedingungen nicht zur Überprüfung<br />
der dritten These (das Unbewusste) herangeholt werden, da keine experimentelle Variation<br />
bzgl. der 'Zurückdrängung' vorgenommen wurde. Wie im ersten Experiment könne man, laut<br />
Grünbaum, nicht behaupten, dass das kognitiv-affektive Situationsfeld, das Motley in seinen<br />
Bedingungen erzeugte, <strong>von</strong> den Versuchspersonen verdrängt worden war. Die Probanden in<br />
der ‘Electricity-Set’-Bedingung erwarteten ganz bewusst den (angeblichen) Elektroschock