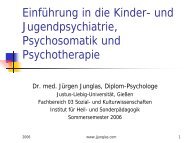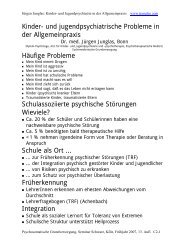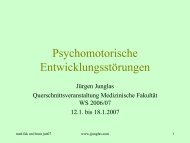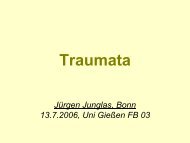Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Experimentelle Untersuchung von Versprechern bei Zwangspatienten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Experimentelle</strong> <strong>Untersuchung</strong> <strong>von</strong> <strong>Versprechern</strong> <strong>bei</strong> <strong>Zwangspatienten</strong><br />
Auswahl auch <strong>von</strong> der Perspektive des Sprechers abhängt. So kann das gleiche Bild<br />
eines Schafes und einer Ziege in Form <strong>von</strong> „Dort steht ein Schaf und links <strong>von</strong> ihm<br />
steht eine Ziege“ oder „Dort steht eine Ziege und rechts <strong>von</strong> ihr steht ein Schaf“<br />
ausgedrückt werden (Indefrey & Levelt, 2000; vgl. auch Junglas, 2002). Die Selektion<br />
der lexikalischen Konzepte findet unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte statt.<br />
(2) Die aktiven Konzeptknoten leiten im darauffolgenden Schritt ihre Aktivierung an die<br />
nächste Ebene, das Lemma Stratum, das die syntaktischen Eigenschaften der Wörter<br />
repräsentiert. Das Lemma für „Beruf“ zum Beispiel enthält die Information, dass es<br />
sich um ein Nomen handelt und dass das Wortgeschlecht männlich ist. Hier<strong>bei</strong> handelt<br />
es sich um eine abstrakte, nicht phonologische Repräsentation. Die hieraus gebildeten<br />
Phrasen (Nominal-, Präpositional-, Verbalphrase etc.) eines Satzes werden zu einer<br />
Oberflächenstruktur zusammengesetzt (morphophonologische Encodierung und<br />
Syllabifizierung).<br />
(3) Das Form Stratum repräsentiert den phonologischen Wortcode und den Speicher<br />
syllabischer Gesten (Syllabifizierung). Nach Selektion des Ziellemmas strömt die<br />
Aktivierung in diese dritte Ebene zu einem oder mehreren Morphemknoten. Levelt et<br />
al. (1999) gehen da<strong>von</strong> aus, dass morphologisch komplexe Wörter, z.B.<br />
„Schokopudding“ (Wort + Wort) oder „köstlich“ (Wortstamm + Affix) in Form<br />
separater Morpheme sowie eines dazugehörigen morphologischen Rahmens<br />
repräsentiert sind. Versprecher geben Hinweise für eine morphologische Struktur <strong>bei</strong><br />
der Sprachproduktion, da Wortstämme vertauscht werden können, wo<strong>bei</strong> Affixe an<br />
ihrem Platz bleiben (z.B. „funny to get your model renosed“ anstatt „funny to get your<br />
nose remodeled“) oder Affixe werden verschoben, dafür bleiben Wortstämme an<br />
ihrem Platz (z.B. „what that add ups to“ anstatt „what that adds up to“) (aus<br />
Jescheniak, 2002; siehe auch Junglas, 2002). Das phonologische Encodieren beginnt<br />
erst, wenn der Selektionsprozess auf der Lemmaebene abgeschlossen ist (z.B.<br />
Butterworth, 1989; Fromkin, 1971; Garrett, 1980; Levelt, 1989; Levelt et al., 1999).<br />
Die Morphemknoten verbreiten ihre Aktivierung auf die mit ihnen verbundenen<br />
Phonemknoten. Für ein häufig verwendetes Wort (wie Gabel) ist die Geschwindigkeit<br />
des Zugangs zum phonologischen Code größer als für ein selten verwendetes Wort<br />
(wie Giebel). Dieser Code wird dazu benutzt, die Silben des Wortes in einem<br />
schnellen seriellen Prozess zusammenzustellen (Syllabifizierung). Für „Gabel“ wird<br />
47