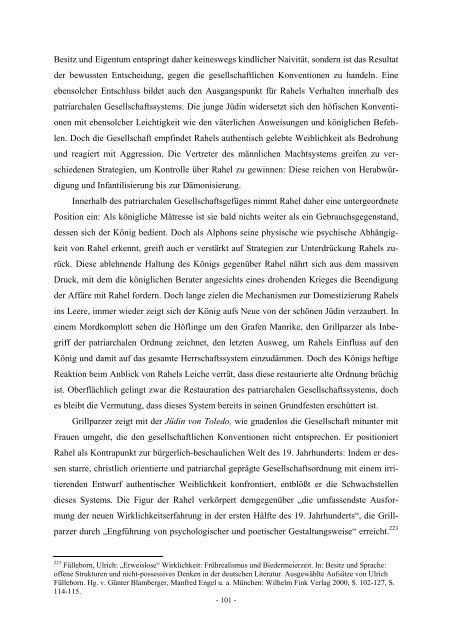DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Besitz und Eigentum entspringt daher keineswegs kindlicher Naivität, sondern ist das Resultat<br />
der bewussten Entscheidung, gegen die gesellschaftlichen Konventionen zu handeln. Eine<br />
ebensolcher Entschluss bildet auch den Ausgangspunkt <strong>für</strong> Rahels Verhalten innerhalb des<br />
patriarchalen Gesellschaftssystems. Die junge Jüdin widersetzt sich den höfischen Konventionen<br />
mit ebensolcher Leichtigkeit wie den väterlichen Anweisungen und königlichen Befehlen.<br />
Doch die Gesellschaft empfindet Rahels authentisch gelebte Weiblichkeit als Bedrohung<br />
und reagiert mit Aggression. Die Vertreter des männlichen Machtsystems greifen zu verschiedenen<br />
Strategien, um Kontrolle über Rahel zu gewinnen: Diese reichen von Herabwürdigung<br />
und Infantilisierung bis zur Dämonisierung.<br />
Innerhalb des patriarchalen Gesellschaftsgefüges nimmt Rahel daher eine untergeordnete<br />
Position ein: Als königliche Mätresse ist sie bald nichts weiter als ein Gebrauchsgegenstand,<br />
dessen sich der König bedient. Doch als Alphons seine physische wie psychische Abhängigkeit<br />
von Rahel erkennt, greift auch er verstärkt auf Strategien zur Unterdrückung Rahels zurück.<br />
Diese ablehnende Haltung des Königs gegenüber Rahel nährt sich aus dem massiven<br />
Druck, mit dem die königlichen Berater angesichts eines drohenden Krieges die Beendigung<br />
der Affäre mit Rahel fordern. Doch lange zielen die Mechanismen zur Domestizierung Rahels<br />
ins Leere, immer wieder zeigt sich der König aufs Neue von der schönen Jüdin verzaubert. In<br />
einem Mordkomplott sehen die Höflinge um den Grafen Manrike, den Grillparzer als Inbegriff<br />
der patriarchalen Ordnung zeichnet, den letzten Ausweg, um Rahels Einfluss auf den<br />
König und damit auf das gesamte Herrschaftssystem einzudämmen. Doch des Königs heftige<br />
Reaktion beim Anblick von Rahels Leiche verrät, dass diese restaurierte alte Ordnung brüchig<br />
ist. Oberflächlich gelingt zwar die Restauration des patriarchalen Gesellschaftssystems, doch<br />
es bleibt die Vermutung, dass dieses System bereits in seinen Grundfesten erschüttert ist.<br />
Grillparzer zeigt mit der Jüdin von Toledo, wie gnadenlos die Gesellschaft mitunter mit<br />
Frauen umgeht, die den gesellschaftlichen Konventionen nicht entsprechen. Er positioniert<br />
Rahel als Kontrapunkt zur bürgerlich-beschaulichen Welt des 19. Jahrhunderts: Indem er dessen<br />
starre, christlich orientierte und patriarchal geprägte Gesellschaftsordnung mit einem irritierenden<br />
Entwurf authentischer Weiblichkeit konfrontiert, entblößt er die Schwachstellen<br />
dieses Systems. Die Figur der Rahel verkörpert demgegenüber „die umfassendste Ausformung<br />
der neuen Wirklichkeitserfahrung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, die Grillparzer<br />
durch „Engführung von psychologischer und poetischer Gestaltungsweise“ erreicht. 223<br />
223 Fülleborn, Ulrich: „Erweislose“ Wirklichkeit: Frührealismus und Biedermeierzeit. In: Besitz und Sprache:<br />
offene Strukturen und nicht-possessives Denken in der deutschen Literatur. Ausgewählte Aufsätze von Ulrich<br />
Fülleborn. Hg. v. Günter Blamberger, Manfred Engel u. a. München: Wilhelm Fink Verlag 2000, S. 102-127, S.<br />
114-115.<br />
- 101 -