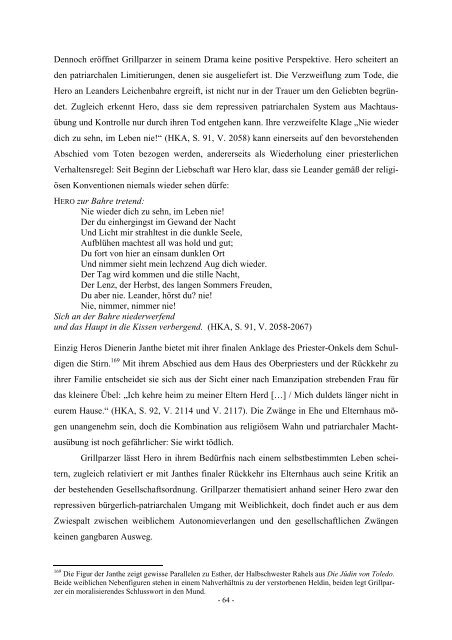DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dennoch eröffnet Grillparzer in seinem Drama keine positive Perspektive. Hero scheitert an<br />
den patriarchalen Limitierungen, denen sie ausgeliefert ist. Die Verzweiflung zum Tode, die<br />
Hero an Leanders Leichenbahre ergreift, ist nicht nur in der Trauer um den Geliebten begründet.<br />
Zugleich erkennt Hero, dass sie dem repressiven patriarchalen System aus Machtausübung<br />
und Kontrolle nur durch ihren Tod entgehen kann. Ihre verzweifelte Klage „Nie wieder<br />
dich zu sehn, im Leben nie!“ (HKA, S. 91, V. 2058) kann einerseits auf den bevorstehenden<br />
Abschied vom Toten bezogen werden, andererseits als Wiederholung einer priesterlichen<br />
Verhaltensregel: Seit Beginn der Liebschaft war Hero klar, dass sie Leander gemäß der religiösen<br />
Konventionen niemals wieder sehen dürfe:<br />
HERO zur Bahre tretend:<br />
Nie wieder dich zu sehn, im Leben nie!<br />
Der du einhergingst im Gewand der Nacht<br />
Und Licht mir strahltest in die dunkle Seele,<br />
Aufblühen machtest all was hold und gut;<br />
Du fort von hier an einsam dunklen Ort<br />
Und nimmer sieht mein lechzend Aug dich wieder.<br />
Der Tag wird kommen und die stille Nacht,<br />
Der Lenz, der Herbst, des langen Sommers Freuden,<br />
Du aber nie. Leander, hörst du? nie!<br />
Nie, nimmer, nimmer nie!<br />
Sich an der Bahre niederwerfend<br />
und das Haupt in die Kissen verbergend. (HKA, S. 91, V. 2058-2067)<br />
Einzig Heros Dienerin Janthe bietet mit ihrer finalen Anklage des Priester-Onkels dem Schuldigen<br />
die Stirn. 169 Mit ihrem Abschied aus dem Haus des Oberpriesters und der Rückkehr zu<br />
ihrer Familie entscheidet sie sich aus der Sicht einer nach Emanzipation strebenden Frau <strong>für</strong><br />
das kleinere Übel: „Ich kehre heim zu meiner Eltern Herd […] / Mich duldets länger nicht in<br />
eurem Hause.“ (HKA, S. 92, V. 2114 und V. 2117). Die Zwänge in Ehe und Elternhaus mögen<br />
unangenehm sein, doch die Kombination aus religiösem Wahn und patriarchaler Machtausübung<br />
ist noch gefährlicher: Sie wirkt tödlich.<br />
Grillparzer lässt Hero in ihrem Bedürfnis nach einem selbstbestimmten Leben scheitern,<br />
zugleich relativiert er mit Janthes finaler Rückkehr ins Elternhaus auch seine Kritik an<br />
der bestehenden Gesellschaftsordnung. Grillparzer thematisiert anhand seiner Hero zwar den<br />
repressiven bürgerlich-patriarchalen Umgang mit Weiblichkeit, doch findet auch er aus dem<br />
Zwiespalt zwischen weiblichem Autonomieverlangen und den gesellschaftlichen Zwängen<br />
keinen gangbaren Ausweg.<br />
169 Die Figur der Janthe zeigt gewisse Parallelen zu Esther, der Halbschwester Rahels aus Die Jüdin von Toledo.<br />
Beide weiblichen Nebenfiguren stehen in einem Nahverhältnis zu der verstorbenen Heldin, beiden legt Grillparzer<br />
ein moralisierendes Schlusswort in den Mund.<br />
- 64 -