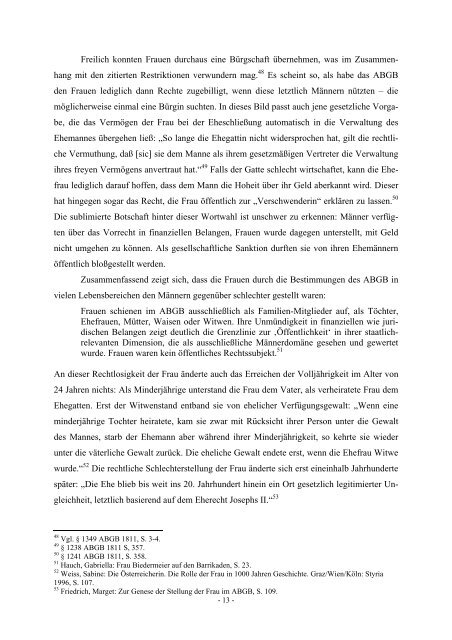DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Freilich konnten Frauen durchaus eine Bürgschaft übernehmen, was im Zusammenhang<br />
mit den zitierten Restriktionen verwundern mag. 48 Es scheint so, als habe das ABGB<br />
den Frauen lediglich dann Rechte zugebilligt, wenn diese letztlich Männern nützten – die<br />
möglicherweise einmal eine Bürgin suchten. In dieses Bild passt auch jene gesetzliche Vorgabe,<br />
die das Vermögen der Frau bei der Eheschließung automatisch in die Verwaltung des<br />
Ehemannes übergehen ließ: „So lange die Ehegattin nicht widersprochen hat, gilt die rechtliche<br />
Vermuthung, daß [sic] sie dem Manne als ihrem gesetzmäßigen Vertreter die Verwaltung<br />
ihres freyen Vermögens anvertraut hat.“ 49 Falls der Gatte schlecht wirtschaftet, kann die Ehefrau<br />
lediglich darauf hoffen, dass dem Mann die Hoheit über ihr Geld aberkannt wird. Dieser<br />
hat hingegen sogar das Recht, die Frau öffentlich zur „Verschwenderin“ erklären zu lassen. 50<br />
Die sublimierte Botschaft hinter dieser Wortwahl ist unschwer zu erkennen: Männer verfügten<br />
über das Vorrecht in finanziellen Belangen, Frauen wurde dagegen unterstellt, mit Geld<br />
nicht umgehen zu können. Als gesellschaftliche Sanktion durften sie von ihren Ehemännern<br />
öffentlich bloßgestellt werden.<br />
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Frauen durch die Bestimmungen des ABGB in<br />
vielen Lebensbereichen den Männern gegenüber schlechter gestellt waren:<br />
Frauen schienen im ABGB ausschließlich als Familien-Mitglieder auf, als Töchter,<br />
Ehefrauen, Mütter, Waisen oder Witwen. Ihre Unmündigkeit in finanziellen wie juridischen<br />
Belangen zeigt deutlich die Grenzlinie zur ‚Öffentlichkeit‘ in ihrer staatlichrelevanten<br />
Dimension, die als ausschließliche Männerdomäne gesehen und gewertet<br />
wurde. Frauen waren kein öffentliches Rechtssubjekt. 51<br />
An dieser Rechtlosigkeit der Frau änderte auch das Erreichen der Volljährigkeit im Alter von<br />
24 Jahren nichts: Als Minderjährige unterstand die Frau dem Vater, als verheiratete Frau dem<br />
Ehegatten. Erst der Witwenstand entband sie von ehelicher Verfügungsgewalt: „Wenn eine<br />
minderjährige Tochter heiratete, kam sie zwar mit Rücksicht ihrer Person unter die Gewalt<br />
des Mannes, starb der Ehemann aber während ihrer Minderjährigkeit, so kehrte sie wieder<br />
unter die väterliche Gewalt zurück. Die eheliche Gewalt endete erst, wenn die Ehefrau Witwe<br />
wurde.“ 52 Die rechtliche Schlechterstellung der Frau änderte sich erst eineinhalb Jahrhunderte<br />
später: „Die Ehe blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein Ort gesetzlich legitimierter Ungleichheit,<br />
letztlich basierend auf dem Eherecht Josephs II.“ 53<br />
48 Vgl. § 1349 ABGB 1811, S. 3-4.<br />
49 § 1238 ABGB 1811 S, 357.<br />
50 § 1241 ABGB 1811, S. 358.<br />
51 Hauch, Gabriella: Frau Biedermeier auf den Barrikaden, S. 23.<br />
52 Weiss, Sabine: Die Österreicherin. Die Rolle der Frau in 1000 Jahren Geschichte. Graz/<strong>Wien</strong>/Köln: Styria<br />
1996, S. 107.<br />
53 Friedrich, Marget: Zur Genese der Stellung der Frau im ABGB, S. 109.<br />
- 13 -