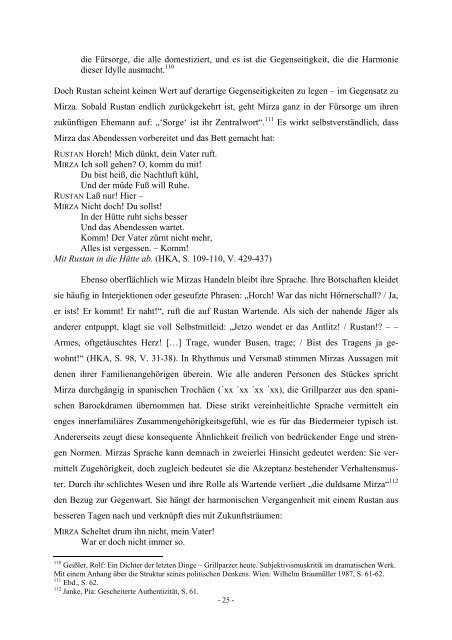DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die Fürsorge, die alle domestiziert, und es ist die Gegenseitigkeit, die die Harmonie<br />
dieser Idylle ausmacht. 110<br />
Doch Rustan scheint keinen Wert auf derartige Gegenseitigkeiten zu legen – im Gegensatz zu<br />
Mirza. Sobald Rustan endlich zurückgekehrt ist, geht Mirza ganz in der Fürsorge um ihren<br />
zukünftigen Ehemann auf: „‘Sorge‘ ist ihr Zentralwort“. 111 Es wirkt selbstverständlich, dass<br />
Mirza das Abendessen vorbereitet und das Bett gemacht hat:<br />
RUSTAN Horch! Mich dünkt, dein Vater ruft.<br />
MIRZA Ich soll gehen? O, komm du mit!<br />
Du bist heiß, die Nachtluft kühl,<br />
Und der müde Fuß will Ruhe.<br />
RUSTAN Laß nur! Hier –<br />
MIRZA Nicht doch! Du sollst!<br />
In der Hütte ruht sichs besser<br />
Und das Abendessen wartet.<br />
Komm! Der Vater zürnt nicht mehr,<br />
Alles ist vergessen. – Komm!<br />
Mit Rustan in die Hütte ab. (HKA, S. 109-110, V. 429-437)<br />
Ebenso oberflächlich wie Mirzas Handeln bleibt ihre Sprache. Ihre Botschaften kleidet<br />
sie häufig in Interjektionen oder geseufzte Phrasen: „Horch! War das nicht Hörnerschall? / Ja,<br />
er ists! Er kommt! Er naht!“, ruft die auf Rustan Wartende. Als sich der nahende Jäger als<br />
anderer entpuppt, klagt sie voll Selbstmitleid: „Jetzo wendet er das Antlitz! / Rustan!? – –<br />
Armes, oftgetäuschtes Herz! […] Trage, wunder Busen, trage; / Bist des Tragens ja gewohnt!“<br />
(HKA, S. 98, V. 31-38). In Rhythmus und Versmaß stimmen Mirzas Aussagen mit<br />
denen ihrer Familienangehörigen überein. Wie alle anderen Personen des Stückes spricht<br />
Mirza durchgängig in spanischen Trochäen (´xx ´xx ´xx ´xx), die Grillparzer aus den spanischen<br />
Barockdramen übernommen hat. Diese strikt vereinheitlichte Sprache vermittelt ein<br />
enges innerfamiliäres Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es <strong>für</strong> das Biedermeier typisch ist.<br />
Andererseits zeugt diese konsequente Ähnlichkeit freilich von bedrückender Enge und strengen<br />
Normen. Mirzas Sprache kann demnach in zweierlei Hinsicht gedeutet werden: Sie vermittelt<br />
Zugehörigkeit, doch zugleich bedeutet sie die Akzeptanz bestehender Verhaltensmuster.<br />
Durch ihr schlichtes Wesen und ihre Rolle als Wartende verliert „die duldsame Mirza“ 112<br />
den Bezug zur Gegenwart. Sie hängt der harmonischen Vergangenheit mit einem Rustan aus<br />
besseren Tagen nach und verknüpft dies mit Zukunftsträumen:<br />
MIRZA Scheltet drum ihn nicht, mein Vater!<br />
War er doch nicht immer so.<br />
110 Geißler, Rolf: Ein Dichter der letzten Dinge – Grillparzer heute. Subjektivismuskritik im dramatischen Werk.<br />
Mit einem Anhang über die Struktur seines politischen Denkens. <strong>Wien</strong>: Wilhelm Braumüller 1987, S. 61-62.<br />
111 Ebd., S. 62.<br />
112 Janke, Pia: Gescheiterte Authentizität, S. 61.<br />
- 25 -