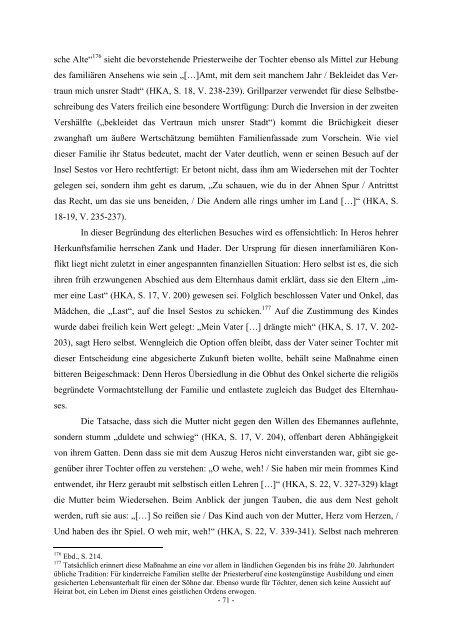DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sche Alte“ 176 sieht die bevorstehende Priesterweihe der Tochter ebenso als Mittel zur Hebung<br />
des familiären Ansehens wie sein „[…]Amt, mit dem seit manchem Jahr / Bekleidet das Vertraun<br />
mich unsrer Stadt“ (HKA, S. 18, V. 238-239). Grillparzer verwendet <strong>für</strong> diese Selbstbeschreibung<br />
des Vaters freilich eine besondere Wortfügung: Durch die Inversion in der zweiten<br />
Vershälfte („bekleidet das Vertraun mich unsrer Stadt“) kommt die Brüchigkeit dieser<br />
zwanghaft um äußere Wertschätzung bemühten Familienfassade zum Vorschein. Wie viel<br />
dieser Familie ihr Status bedeutet, macht der Vater deutlich, wenn er seinen Besuch auf der<br />
Insel Sestos vor Hero rechtfertigt: Er betont nicht, dass ihm am Wiedersehen mit der Tochter<br />
gelegen sei, sondern ihm geht es darum, „Zu schauen, wie du in der Ahnen Spur / Antrittst<br />
das Recht, um das sie uns beneiden, / Die Andern alle rings umher im Land […]“ (HKA, S.<br />
18-19, V. 235-237).<br />
In dieser Begründung des elterlichen Besuches wird es offensichtlich: In Heros hehrer<br />
Herkunftsfamilie herrschen Zank und Hader. Der Ursprung <strong>für</strong> diesen innerfamiliären Konflikt<br />
liegt nicht zuletzt in einer angespannten finanziellen Situation: Hero selbst ist es, die sich<br />
ihren früh erzwungenen Abschied aus dem Elternhaus damit erklärt, dass sie den Eltern „immer<br />
eine Last“ (HKA, S. 17, V. 200) gewesen sei. Folglich beschlossen Vater und Onkel, das<br />
Mädchen, die „Last“, auf die Insel Sestos zu schicken. 177 Auf die Zustimmung des Kindes<br />
wurde dabei freilich kein Wert gelegt: „Mein Vater […] drängte mich“ (HKA, S. 17, V. 202-<br />
203), sagt Hero selbst. Wenngleich die Option offen bleibt, dass der Vater seiner Tochter mit<br />
dieser Entscheidung eine abgesicherte Zukunft bieten wollte, behält seine Maßnahme einen<br />
bitteren Beigeschmack: Denn Heros Übersiedlung in die Obhut des Onkel sicherte die religiös<br />
begründete Vormachtstellung der Familie und entlastete zugleich das Budget des Elternhauses.<br />
Die Tatsache, dass sich die Mutter nicht gegen den Willen des Ehemannes auflehnte,<br />
sondern stumm „duldete und schwieg“ (HKA, S. 17, V. 204), offenbart deren Abhängigkeit<br />
von ihrem Gatten. Denn dass sie mit dem Auszug Heros nicht einverstanden war, gibt sie gegenüber<br />
ihrer Tochter offen zu verstehen: „O wehe, weh! / Sie haben mir mein frommes Kind<br />
entwendet, ihr Herz geraubt mit selbstisch eitlen Lehren […]“ (HKA, S. 22, V. 327-329) klagt<br />
die Mutter beim Wiedersehen. Beim Anblick der jungen Tauben, die aus dem Nest geholt<br />
werden, ruft sie aus: „[…] So reißen sie / Das Kind auch von der Mutter, Herz vom Herzen, /<br />
Und haben des ihr Spiel. O weh mir, weh!“ (HKA, S. 22, V. 339-341). Selbst nach mehreren<br />
176 Ebd., S. 214.<br />
177 Tatsächlich erinnert diese Maßnahme an eine vor allem in ländlichen Gegenden bis ins frühe 20. Jahrhundert<br />
übliche Tradition: Für kinderreiche Familien stellte der Priesterberuf eine kostengünstige Ausbildung und einen<br />
gesicherten Lebensunterhalt <strong>für</strong> einen der Söhne dar. Ebenso wurde <strong>für</strong> Töchter, denen sich keine Aussicht auf<br />
Heirat bot, ein Leben im Dienst eines geistlichen Ordens erwogen.<br />
- 71 -