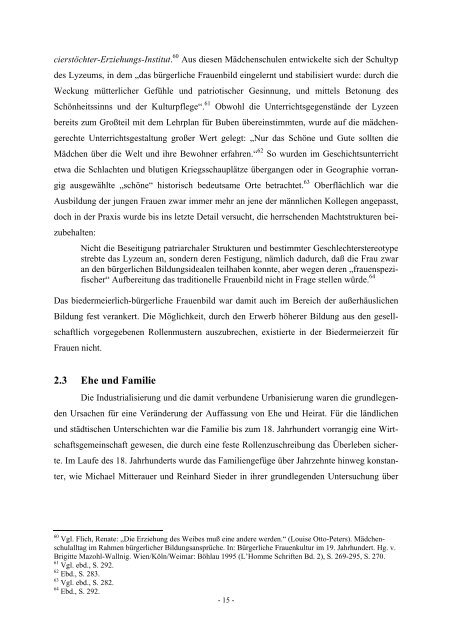DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
DIPLOMARBEIT - Institut für Germanistik - Universität Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
cierstöchter-Erziehungs-<strong>Institut</strong>. 60 Aus diesen Mädchenschulen entwickelte sich der Schultyp<br />
des Lyzeums, in dem „das bürgerliche Frauenbild eingelernt und stabilisiert wurde: durch die<br />
Weckung mütterlicher Gefühle und patriotischer Gesinnung, und mittels Betonung des<br />
Schönheitssinns und der Kulturpflege“. 61 Obwohl die Unterrichtsgegenstände der Lyzeen<br />
bereits zum Großteil mit dem Lehrplan <strong>für</strong> Buben übereinstimmten, wurde auf die mädchengerechte<br />
Unterrichtsgestaltung großer Wert gelegt: „Nur das Schöne und Gute sollten die<br />
Mädchen über die Welt und ihre Bewohner erfahren.“ 62 So wurden im Geschichtsunterricht<br />
etwa die Schlachten und blutigen Kriegsschauplätze übergangen oder in Geographie vorrangig<br />
ausgewählte „schöne“ historisch bedeutsame Orte betrachtet. 63 Oberflächlich war die<br />
Ausbildung der jungen Frauen zwar immer mehr an jene der männlichen Kollegen angepasst,<br />
doch in der Praxis wurde bis ins letzte Detail versucht, die herrschenden Machtstrukturen beizubehalten:<br />
Nicht die Beseitigung patriarchaler Strukturen und bestimmter Geschlechterstereotype<br />
strebte das Lyzeum an, sondern deren Festigung, nämlich dadurch, daß die Frau zwar<br />
an den bürgerlichen Bildungsidealen teilhaben konnte, aber wegen deren „frauenspezifischer“<br />
Aufbereitung das traditionelle Frauenbild nicht in Frage stellen würde. 64<br />
Das biedermeierlich-bürgerliche Frauenbild war damit auch im Bereich der außerhäuslichen<br />
Bildung fest verankert. Die Möglichkeit, durch den Erwerb höherer Bildung aus den gesellschaftlich<br />
vorgegebenen Rollenmustern auszubrechen, existierte in der Biedermeierzeit <strong>für</strong><br />
Frauen nicht.<br />
2.3 Ehe und Familie<br />
Die Industrialisierung und die damit verbundene Urbanisierung waren die grundlegenden<br />
Ursachen <strong>für</strong> eine Veränderung der Auffassung von Ehe und Heirat. Für die ländlichen<br />
und städtischen Unterschichten war die Familie bis zum 18. Jahrhundert vorrangig eine Wirtschaftsgemeinschaft<br />
gewesen, die durch eine feste Rollenzuschreibung das Überleben sicherte.<br />
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde das Familiengefüge über Jahrzehnte hinweg konstanter,<br />
wie Michael Mitterauer und Reinhard Sieder in ihrer grundlegenden Untersuchung über<br />
60 Vgl. Flich, Renate: „Die Erziehung des Weibes muß eine andere werden.“ (Louise Otto-Peters). Mädchenschulalltag<br />
im Rahmen bürgerlicher Bildungsansprüche. In: Bürgerliche Frauenkultur im 19. Jahrhundert. Hg. v.<br />
Brigitte Mazohl-Wallnig. <strong>Wien</strong>/Köln/Weimar: Böhlau 1995 (L’Homme Schriften Bd. 2), S. 269-295, S. 270.<br />
61 Vgl. ebd., S. 292.<br />
62 Ebd., S. 283.<br />
63 Vgl. ebd., S. 282.<br />
64 Ebd., S. 292.<br />
- 15 -