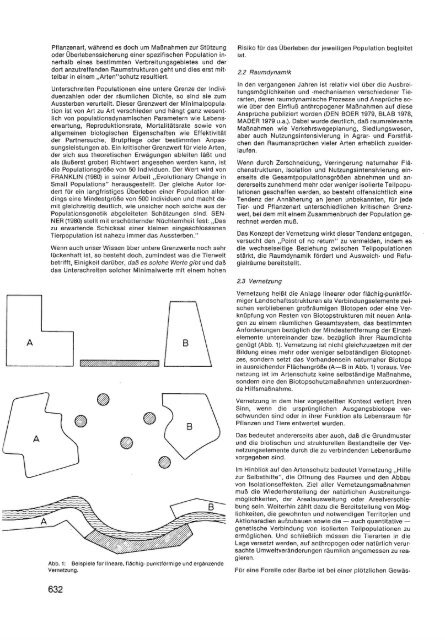Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
A<br />
A<br />
Pflanzenart, während es doch um Maßnahmen zur Stützung<br />
oder Überlebenssicherung einer spezifischen Population innerhalb<br />
eines bestimmten Verbreitungsgebietes und der<br />
dort anzutreffenden Raumstrukturen geht und dies erst mittelbar<br />
in einem „ Arten" schutz resultiert.<br />
Unterschreiten Populationen eine untere Grenze der lndividuenzahlen<br />
oder der räumlichen Dichte, so sind sie zum<br />
Aussterben verurteilt. Dieser Grenzwert der Minimalpopulation<br />
ist von Art zu Art verschieden und hängt ganz wesentlich<br />
vo n populationsdynamischen Parametern wie Lebenserwartung,<br />
Reproduktionsrate, Mortalitätsrate sowie von<br />
allgemeinen biologischen Eigenschaften wie Effektivität<br />
der Partnersuche, Brutpflege oder bestimmten Anpassungsleistungen<br />
ab. Ein kritischer Grenzwert für viele Arten,<br />
der sich aus theoretischen Erwägungen ableiten läßt und<br />
als (äußerst grober) Richtwert angesehen werden kann, ist<br />
die Populationsgröße von 50 Individuen. Der Wert wird von<br />
FRANKLIN (1980) in seiner Arbeit „ Evolutionary Change in<br />
Small Populations" herausgestellt. Der gleiche Autor fordert<br />
für ein langfristiges Überleben einer Population allerdings<br />
eine Mindestgröße von 500 Individuen und macht damit<br />
gleichzeitig deutlich, wie unsicher noch solche aus der<br />
Populationsgenetik abgeleiteten Schätzungen sind. SEN<br />
NER (1980) stellt mit erschütternder Nüchternheit fest: „ Das<br />
zu erwartende Schicksal einer kleinen eingeschlossenen<br />
Tierpopulation ist nahezu immer das Aussterben."<br />
Wenn auch unser Wissen Ober untere Grenzwerte noch sehr<br />
lückenhaft ist, so besteht doch, zumindest was die Tierwelt<br />
betrifft, Einigkeit darüber, daß es solche Werte gibt und daß<br />
das Unterschreiten solcher Minimalwerte mit einem hohen<br />
Abb. 1: Beispiele for lineare, flächig- punktförmlge und ergänzende<br />
Vernetzung.<br />
632<br />
B<br />
B<br />
Risiko für das Überleben der jeweiligen Population begleitet<br />
ist.<br />
2.2 Raumdynamik<br />
In den vergangenen Jahren ist relativ viel Ober die Ausbreitungsmöglichkeiten<br />
und -mechanismen verschiedener Tierarten,<br />
deren raumdynamische Prozesse und Ansprüche sowie<br />
Ober den Einfluß anthropogener Maßnahmen auf diese<br />
Ansprüche publiziert worden (DEN BOER 1979, BLAB 1978,<br />
MADER 1979 u.a.). Dabei wurde deutlich, daß raumrelevante<br />
Maßnahmen wie Verkehrswegeplanung, Siedlungswesen,<br />
aber auch Nutzungsintensivierung in Agrar- und Forstflächen<br />
den Raumansprüchen vieler Arten erheblich zuwiderlaufen.<br />
Wenn durch Zerschneidung, Verringerung naturnaher Flächenstrukturen,<br />
Isolation und Nutzungsintensivierung einerseits<br />
die Gesamtpopulationsgrößen abnehmen und andererseits<br />
zunehmend mehr oder weniger isolierte Teilpopulationen<br />
geschaffen werden, so besteht offensichtlich eine<br />
Tendenz der Annäherung an jenen unbekannten, für jede<br />
Tier- und Pflanzenart unterschiedlichen kritischen Grenzwert,<br />
bei dem mit einem Zusammenbruch der Population gerechnet<br />
werden muß.<br />
Das Konzept der Vernetzung wirkt dieser Tendenz entgegen,<br />
versucht den „Point of no return" zu vermelden, indem es<br />
die wechselseitige Beziehung zwischen Teilpopulationen<br />
stärkt, die Raumdynamik fördert und Ausweich- und Refugialräume<br />
bereitstellt.<br />
2.3 Vernetzung<br />
Vernetzung heißt die Anlage linearer oder flächig-punktförmiger<br />
Landschaftsstrukturen als Verbindungselemente zwischen<br />
verbliebenen großräumigen Biotopen oder eine Verknüpfung<br />
von Resten von Biotopstrukturen mit neuen Anlagen<br />
zu einem räumlichen Gesamtsystem, das bestimmten<br />
Anforderungen bezüglich der Mindestentfernung der Einzelelemente<br />
untereinander bzw. bezüglich ihrer Raumdichte<br />
genügt (Abb. 1). Vernetzung ist nicht gleichzusetzen mit der<br />
Bildung eines mehr oder weniger selbständigen Biotopnetzes,<br />
sondern setzt das Vorhandensein naturnaher Biotope<br />
in ausreichender Flächengröße (A-B in Abb. 1) voraus. Vernetzung<br />
ist im <strong>Artenschutz</strong> keine selbständige Maßnahme,<br />
sondern eine den Biotopschutzmaßnahmen unterzuordnende<br />
Hilfsmaßnahme.<br />
Vernetzung in dem hier vorgestellten Kontext verliert ihren<br />
Sinn, wenn die ursprünglichen Ausgangsbiotope verschwunden<br />
sind oder in ihrer Funktion als Lebensraum für<br />
Pflanzen und Tiere entwertet wurden.<br />
Das bedeutet andererseits aber auch, daß die Grundmuster<br />
und die biotischen und strukturellen Bestandteile der Vernetzungselemente<br />
durch die zu verbindenden Lebensräume<br />
vorgegeben sind.<br />
Im Hinblick auf den <strong>Artenschutz</strong> bedeutet Vernetzung „ Hilfe<br />
zur Selbsthilfe", die Öffnung des Raumes und den Abbau<br />
von lsolationseffekten. Ziel aller Vernetzungsmaßnahmen<br />
muß die Wiederherstellung der natürlichen Ausbreitungsmöglichkeiten,<br />
der Arealausweitung oder Arealverschie·<br />
bung sein. Weiterhin zählt dazu die Bereitstellung von Möglichkeiten,<br />
die gewohnten und notwendigen Territorien und<br />
Aktionsradien aufzubauen sowie die - auch quantitative -<br />
genetische Verbindung von isolierten Teilpopulationen zu<br />
ermöglichen. Und schließlich müssen die Tierarten in die<br />
Lage versetzt werden, auf anthropogen oder natürlich verursachte<br />
Umweltveränderungen räumlich angemessen zu reagieren.<br />
Für eine Forelle oder Barbe ist bei einer plötzlichen Gewäs-