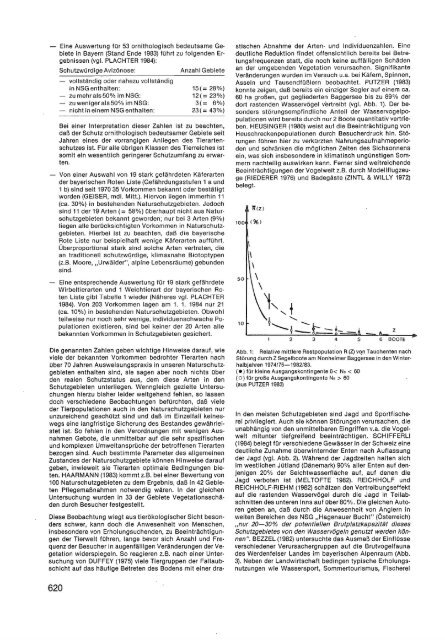Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eine Auswertung für 53 ornithologisch bedeutsame Gebiete<br />
in Bayern (Stand Ende 1983) führt zu folgenden Ergebnissen<br />
(vgl. PLACHTER 1984):<br />
Schutzwürdige Avizönose:<br />
vollständig oder nahezu vollständig<br />
in NSG enthalten:<br />
zu mehr als 50% im NSG:<br />
zu weniger als 50% im NSG:<br />
nicht in einem NSG enthalten:<br />
Anzahl Gebiete<br />
15(= 28%)<br />
12(= 23%)<br />
3(= 6%)<br />
23(= 43%)<br />
Bei einer Interpretation dieser Zahlen ist zu beachten,<br />
daß der Schutz ornithologisch bedeutsamer Gebiete seit<br />
Jahren eines der vorrangigen Anliegen des Tierartenschutzes<br />
ist. Für alle übrigen Klassen des Tierreiches ist<br />
somit ein wesentlich geringerer Schi.Jtzumfang zu erwarten.<br />
- Von einer Auswahl von 19 stark gefährdeten Käferarten<br />
der bayerischen Roten Liste (Gefährdungsstufen 1 a und<br />
1 b) sind seit 1970 35 Vorkommen bekannt oder bestätigt<br />
worden (GEISER, mdl. Mit!.). Hiervon liegen immerhin 11<br />
(ca. 30%) in bestehenden Naturschutzgebieten. Jedoch<br />
sind 11 der 19 Arten ( = 58%) überhaupt nicht aus Naturschutzgebieten<br />
bekannt geworden; nur bei 3 Arten (9%)<br />
liegen alle berücksichtigten Vorkommen in Naturschutzgebieten.<br />
Hierbei ist zu beachten, daß die bayerische<br />
Rote Liste nur beispielhaft wenige Käferarten aufführt.<br />
Überproportional stark sind solche Arten vertreten, die<br />
an traditionell schutzw~rdige , klimaxnahe Biotoptypen<br />
(z.B. Moore, „ Urwälder", alpine Lebensräume) gebunden<br />
sind.<br />
- Eine entsprechende Auswertung für 19 stark gefährdete<br />
Wirbeltierarten und 1 Weichtierart der bayerischen Roten<br />
Liste gibt Tabelle 1 wieder (Näheres vgl. PLACHTER<br />
1984). Von 203 Vorkommen lagen am 1. 1. 1984 nur 21<br />
(ca. 10%) in bestehenden Naturschutzgebieten. Obwohl<br />
teilweise nur noch sehr wenige, individuenschwache Populationen<br />
existieren, sind bei keiner der 20 Arten alle<br />
bekannten Vorkommen in Schutzgebieten gesichert.<br />
Die genannten Zahlen geben wichtige Hinweise darauf, wie<br />
viele der bekannten Vorkommen bedrohter Tierarten nach<br />
über 70 Jahren Ausweisungspraxis in unseren Naturschutzgebieten<br />
enthalten sind, sie sagen aber noch nichts über<br />
den realen Schutzstatus aus, dem diese Arten in den<br />
Schutzgebieten unterliegen. Wenngleich gezielte Untersuchungen<br />
hierzu bisher leider weitgehend fehlen, so lassen<br />
doch verschiedene Beobachtungen befürchten, daß viele<br />
der Tierpopulationen auch in den Naturschutzgebieten nur<br />
unzureichend geschützt sind und daß im Einzelfall keineswegs<br />
eine langfristige Sicherung des Bestandes gewährleistet<br />
ist. So fehlen in den Verordnungen mit wenigen Ausnahmen<br />
Gebote, die unmittelbar auf die sehr spezifischen<br />
und komplexen Umweltansprüche der betroffenen Tierarten<br />
bezogen sind. Auch bestimmte Parameter des allgemeinen<br />
Zustandes der Naturschutzgebiete können Hinweise darauf<br />
geben, inwieweit sie Tierarten optimale Bedingungen bieten.<br />
HAARMANN (1983) kommt z.B. bei einer Bewertung von<br />
100 Naturschutzgebieten zu dem Ergebnis, daß in 42 Gebieten<br />
Pflegemaßnahmen notwendig wären. In der gleichen<br />
Untersuchung wurden in 33 der Gebiete Vegetationsschäden<br />
durch Besucher festgestellt.<br />
Diese Beobachtung wiegt aus tierökologischer Sicht besonders<br />
schwer, kann doch die Anwesenheit von Menschen,<br />
insbesondere von Erholungsuchenden, zu Beeinträchtigungen<br />
der Tierwelt führen, lange bevor sich Anzahl und Frequenz<br />
der Besucher in augenfälligen Veränderungen der Vegetation<br />
widerspiegeln. So reagieren z.B. nach einer Untersuchung<br />
von DUFFEY (1975) viele Tierg ruppen der Fallaubschicht<br />
auf das häufige Betreten des Bodens mit einer dra-<br />
stischen Abnahme der Arten- und lndividuenzahlen. Eine<br />
deutliche Reduktion findet offensichtlich bereits bei Betretungsfrequenzen<br />
statt, die noch keine auffälligen Schäden<br />
an der umgebenden Vegetation verursachen. Signifikante<br />
Veränderungen wurden im Versuch u.a. bei Käfern, Spinnen,<br />
Asseln und Tausendfüßlern beobachtet. PUTZER (1983)<br />
konnte zeigen, daß bereits ein einziger Segler auf einem ca.<br />
60 ha großen, gut gegliederten Baggersee bis zu 89% der<br />
dort rastenden Wasservögel vertreibt (vgl. Abb. 1). Der besonders<br />
störungsempfindliche Anteil der Wasservogelpopulationen<br />
wird bereits durch nur 2 Boote quantitativ vertrieben.<br />
HEUSINGER (1980) weist auf die Beeinträchtigung von<br />
Heuschreckenpopulationen durch Besucherdruck hin. Störungen<br />
führen hier zu verkürzten Nahrungsaufnahmeperioden<br />
und schränken die möglichen Zeiten des Sichsonnens<br />
ein, was sich insbesondere in klimatisch ungünstigen Sommern<br />
nachteilig auswirken kann. Ferner sind weitreichende<br />
Beeinträchtigungen der Vogelwelt z.B. durch Modellflugzeuge<br />
(RIEDERER 1976) und Badegäste (ZINTL & WILLY 1972)<br />
belegt.<br />
~(Z)<br />
100 ( 96)<br />
50<br />
10<br />
1<br />
\<br />
\<br />
\<br />
\<br />
~'-, t<br />
~ '--~ i-:..::: L. -<br />
2 3 4<br />
z<br />
5 6 BOOTE<br />
Abb. 1: Relative mittlere Restpopulation R (Z) v~n Tauchenten nach<br />
Störung durch Z Segelboote am Nonheimer Baggersee in den Winter·<br />
halbjahren 1974/75-1982/83.<br />
(•) für kleine Ausgangskontingente 6 < No < 60<br />
( o ) für große Ausgangskontingente No > 60<br />
(aus PUTZER 1983)<br />
In den meisten Schutzgebieten sind Jagd und Sportfischerei<br />
privilegiert. Auch sie können Störungen verursachen, die<br />
unabhängig von den unmittelbaren Eingriffen v.a. die Vogelwelt<br />
mitunter tiefgreifend beeinträchtigen. SCHIFFERLI<br />
(1984) belegt für verschiedene Gewässer in der Schweiz eine<br />
deutliche Zunahme überwinternder Enten nach Auflassung<br />
der Jagd (vgl. Abb. 2). Während der Jagdzeiten halten sich<br />
im westlichen Jütland (Dänemark) 90% aller Enten auf denjenigen<br />
20% der Seichtwasserfläche auf, auf denen die<br />
Jagd verboten ist (MELTOFTE 1982). REICHHOLF und<br />
REICHHOLF-RIEHM (1982) schätzen den Vertreibungseffekt<br />
auf die rastenden Wasservögel durch die Jagd in Teilabschnitten<br />
des unteren lnns auf über 80%. Die gleichen Autoren<br />
geben an, daß durch die Anwesenheit von Anglern in<br />
weiten Bereichen des NSG „Hagenauer Bucht" (Österreich)<br />
„ nur 20- 30% der potentiellen Brutplatzkapazität dieses<br />
Schutzgebietes von den Wasservögeln genutzt werden können".<br />
BEZZEL (1982) untersuchte das Ausmaß der Einflüsse<br />
verschiedener Verursachergruppen auf die Brutvogelfauna<br />
des Werdenfelser Landes im bayerischen Alpenraum (Abb.<br />
3). Neben der Landwirtschaft bedingen typische Erholungsnutzungen<br />
wie Wassersport, Sommertourismus, Fischerei<br />
620