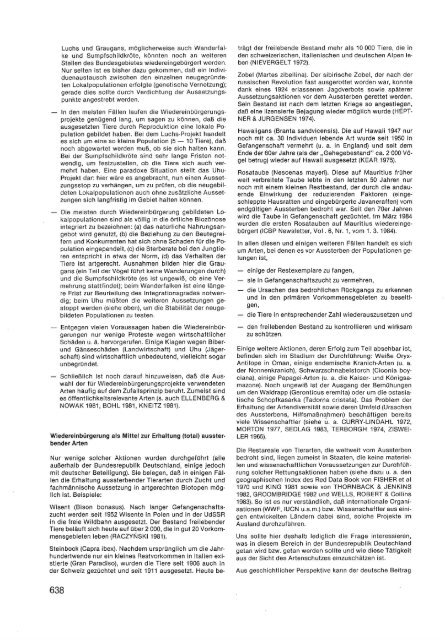Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Luchs und Graugans, möglicherweise auch Wanderfalke<br />
und Sumpfschildkröte, könnten noch an weiteren<br />
Stellen des Bundesgebietes wiedereingebürgert werden.<br />
Nur selten ist es bisher dazu gekommen, daß ein lndividuenaustausch<br />
zwischen den einzelnen neugegründeten<br />
Lokalpopulationen erfolgte (genetische Vernetzung);<br />
gerade dies sollte durch Verdichtung der Aussetzungspunkte<br />
angestrebt werden.<br />
In den meisten Fällen laufen die Wiedereinbürgerungsprojekte<br />
genügend lang, um sagen zu können, daß die<br />
ausgesetzten Tiere durch Reproduktion eine lokale Population<br />
gebildet haben. Bei dem Luchs-Projekt handelt<br />
es sich um eine so kleine Population (5 - 10 Tiere), daß<br />
noch abgewartet werden muß, ob sie sich halten kann.<br />
Bei der Sumpfschildkröte sind sehr lange Fristen notwendig,<br />
um festzustellen, ob die Tiere sich auch vermehrt<br />
haben. Eine paradoxe Situation stellt das Uhu<br />
Projekt dar: hier wäre es angebracht, nun einen Aussetzungsstop<br />
zu verhängen, um zu prüfen, ob die neugebildeten<br />
Lokalpopulationen auch ohne zusätzliche Aussetzungen<br />
sich langfristig im Gebiet halten können.<br />
- Die meisten durch Wiedereinbürgerung gebildeten Lokalpopulationen<br />
sind als völlig in die örtliche Biozönose<br />
integriert zu bezeichnen: (a) das natürliche Nahrungsangebot<br />
wird genutzt, (b) die Beziehung zu den Beutegreifern<br />
und Konkurrenten hat sich ohne Schaden für die Population<br />
eingependelt, (c) die Sterberate bei den Jungtieren<br />
entspricht in etwa der Norm, (d) das Verhalten der<br />
Tiere ist artgerecht. Ausnahmen bilden hier die Graugans<br />
(ein Teil der Vögel führt keine Wanderungen durch)<br />
und die Sumpfschildkröte (es ist ungewiß, ob eine Vermehrung<br />
stattfindet); beim Wanderfalken ist eine längere<br />
Frist zur Beurteilung des Integrationsgrades notwendig;<br />
beim Uhu müßten die weiteren Aussetzungen gestoppt<br />
werden (siehe oben), um die Stabilität der neugebildeten<br />
Populationen zu testen.<br />
- Entgegen vielen Voraussagen haben die Wiedereinbürgerungen<br />
nur wenige Proteste wegen wirtschaftlicher<br />
Schäden u.ä. hervorgerufen. Einige Klagen wegen Biberund<br />
Gänseschäden (Landwirtschaft) und Uhu (Jägerschaft)<br />
sind wirtschaftlich unbedeutend, vielleicht sogar<br />
unbegründet.<br />
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Auswahl<br />
der für Wiedereinbürgerungsprojekte verwendeten<br />
Arten häufig auf dem Zufallsprinzip beruht. Zumeist sind<br />
es öffentlichkeitsrelevante Arten (s. auch ELLENBERG &<br />
NOWAK 1981, BOHL 1981, KNEITZ 1981).<br />
Wiedereinbürgerung als Mittel zur Erhaltung (total) aussterbender<br />
Arten<br />
Nur wenige solcher Aktionen wurden durchgeführt (alle<br />
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, einige jedoch<br />
mit deutscher Beteiligung). Sie belegen, daß in einigen Fällen<br />
die Erhaltung aussterbender Tierarten durch Zucht und<br />
fachmännische Aussetzung in artgerechten Biotopen möglich<br />
ist. Beispiele:<br />
Wisent (Bison bonasus). Nach langer Gefangenschaftszucht<br />
werden seit 1952 Wisente in Polen und in der UdSSR<br />
in die freie Wildbahn ausgesetzt. Der Bestand freilebender<br />
Tiere beläuft sich heute auf über 2 000, die in gut 20 Vorkommensgebieten<br />
leben (RACZYNSKI 1981).<br />
Steinbock (Capra ibex). Nachdem ursprünglich um die Jahrhundertwende<br />
nur ein kleines Restvorkommen in ltallen existierte<br />
(Gran Paradiso), wurden die Tiere seit 1906 auch in<br />
der Schweiz gezüchtet und seit 1911 ausgesetzt. Heute be-<br />
trägt der freilebende Bestand mehr als 10 000 Tiere, die in<br />
den schweizerischen, italienischen und deutschen Alpen leben<br />
(NIEVERGELT 1972).<br />
Zobel (Martes zibellina). Der sibirische Zobel, der nach der<br />
russischen Revolution fast ausgerottet worden war, konnte<br />
dank eines 1924 erlassenen Jagdverbots sowie späterer<br />
Aussetzungsaktionen vor dem Aussterben gerettet werden.<br />
Sein Bestand ist nach dem letzten Kriege so angestiegen,<br />
daß eine lizensierte Bejagung wieder möglich wurde (HEPT<br />
NER & JURGENSEN 1974).<br />
Hawaiigans (Branta sandvicensis). Die auf Hawaii 1947 nur<br />
noch mit ca. 30 Individuen lebende Art wurde seit 1950 in<br />
Gefangenschaft vermehrt (u. a. in England) und seit dem<br />
Ende der 60er Jahre (als der „Gehegebestand" ca. 2 000 Vögel<br />
betrug) wieder auf Hawaii ausgesetzt (KEAR 1975).<br />
Rosataube (Nesoenas mayeri). Diese auf Mauritius früher<br />
weit verbreitete Taube lebte in den letzten 50 Jahren nur<br />
noch mit einem kleinen Restbestand, der durch die andauernde<br />
Einwirkung der reduzierenden Faktoren (eingeschleppte<br />
Hausratten und eingebürgerte Javaneraffen) vom<br />
endgültigen Aussterben bedroht war. Seit den 70er Jahren<br />
wird die Taube in Gefangenschaft gezüchtet. Im März 1984<br />
wurden die ersten Rosatauben auf Mauritius wiedereingebürgert<br />
(ICBP Newsletter, Vol. 6, Nr. 1, vom 1. 3. 1984).<br />
In allen diesen und einigen weiteren Fällen handelt es sich<br />
um Arten, bei denen es vor Aussterben der Populationen gelungen<br />
ist,<br />
einige der Restexemplare zu fangen,<br />
sie in Gefangenschaftszucht zu vermehren,<br />
die Ursachen des bedrohlichen Rückgangs zu erkennen<br />
und in den primären Vorkommensgebieten zu beseitigen,<br />
- die Tiere in entsprechender Zahl wiederauszusetzen und<br />
- den freilebenden Bestand zu kontrollieren und wirksam<br />
zu schützen.<br />
Einige weitere Aktionen, deren Erfolg zum Teil absehbar ist,<br />
befinden sich im Stadium der Durchführung: Weiße Oryx<br />
Antilope in Oman, einige endemische Kranich-Arten (u. a.<br />
der Nonnenkranich), Schwarzschnabelstorch (Ciconia boyciana),<br />
einige Papagei-Arten (u. a. die Kaiser- und Königsamazone).<br />
Noch ungewiß ist der Ausgang der Bemühungen<br />
um den Waldrapp (Geronticus eremita) oder um die ostasiatische<br />
Schopfkasarka (Tadorna cristata). Das Problem der<br />
Erhaltung der Artendiversität sowie deren Umfeld (Ursachen<br />
des Aussterbens, Hilfsmaßnahmen) beschäftigen bereits<br />
viele Wissenschaftler (siehe u. a. CURRY-LINDAHL 1972,<br />
MORTON 1977, SEDLAG 1983, TERBORGH 1974, ZISWEl<br />
LER 1965).<br />
Die Restareale von Tierarten, die weltweit vom Aussterben<br />
bedroht sind, liegen zumeist in Staaten, die keine materiellen<br />
und wissenschaftlichen Voraussetzungen zur Durchfüh·<br />
rung solcher Rettungsaktionen haben (siehe dazu u. a. den<br />
geographischen Index des Red Data Book von FISHER et al<br />
1970 und KING 1981 sowie von THORNBACK & JENKINS<br />
1982, GROOMBRIDGE 1982 und WELLS, ROBERT & Collins<br />
1983). So ist es nur verständlich, daß internationale Organisationen<br />
(WWF, IUCN u.a.m.) bzw. Wissenschaftler aus einigen<br />
entwickelten Ländern dabei sind, solche Projekte im<br />
Ausland durchzuführen.<br />
Uns sollte hier deshalb lediglich die Frage interessieren,<br />
was in diesem Bereich in der Bundesrepublik Deutschland<br />
getan wird bzw. getan werden sollte und wie diese Tätigkeit<br />
aus der Sicht des <strong>Artenschutz</strong>es einzuschätzen ist.<br />
Aus geschichtlicher Perspektive kann der deutsche Beitrag<br />
638