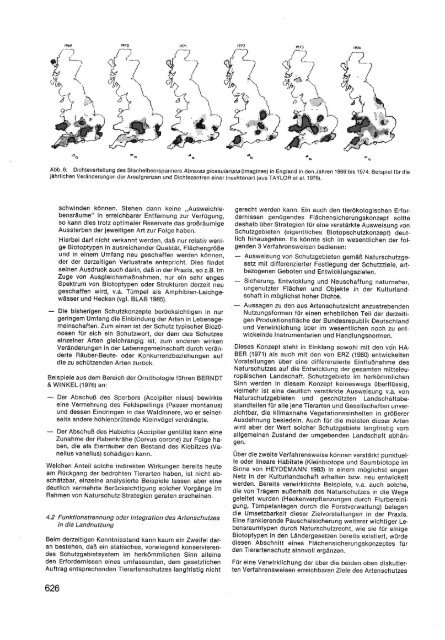Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1969 1971 1971 1913 197.C<br />
{2·<br />
~~ · 177<br />
r f "}~<br />
/J , --<br />
.·i.J ~> . :-'<br />
-t~<br />
~- ~;;,. „<br />
~ ~}0- '<br />
o„ „„ „ ... „<br />
.<br />
0<br />
0 „ „<br />
Abb. 6: Dichtevertellung des Stachelbeerspanners Abraxas g/ossu/ariata (Imagines) In England In den Jahren 1969 bis 1974. Beispiel für die<br />
jährlichen Veränderungen der Arealgrenzen und Dichtezentren einer Insektenart (aus TAYLOR et al. 1978).<br />
schwinden können. Stehen dann keine „ Ausweichlebensräume"<br />
in erreichbarer Entfernung zur Verfügung,<br />
so kann dies trotz optimaler Reservate das großräumige<br />
Aussterben der jeweiligen Art zur Folge haben.<br />
Hierbei darf nicht verkannt werden, daß nur relativ wenige<br />
Biotoptypen in ausreichender Qualität, Flächengröße<br />
und in einem Umfang neu geschaffen werden können,<br />
der der derzeitigen Verlustrate entspricht. Dies findet<br />
seinen Ausdruck auch darin, daß in der Praxis, so z.B. im<br />
Zuge von Ausgleichsmaßnahmen, nur ein sehr enges<br />
Spektrum von Biotoptypen oder Strukturen derzeit neu<br />
geschaffen wird, v.a. Tümpel als Amphibien-Laichgewässer<br />
und Hecken (vgl. BLAB 1985).<br />
Die bisherigen Schutzkonzepte berücksichtigen In nur<br />
geringem Umfang die Einbindung der Arten in Lebensgemeinschaften.<br />
Zum einen ist der Schutz typischer Biozönosen<br />
für sich ein Schutzwert, der dem des Schutzes<br />
einzelner Arten gleichrangig ist, zum anderen wirken<br />
Veränderungen in der Lebensgemeinschaft durch veränderte<br />
Räuber-Beute- oder Konkurrenzbeziehungen auf<br />
die zu schützenden Arten zurück.<br />
Beispiele aus dem Bereich der Ornithologie führen BERNDT<br />
& WINKEL (1976) an:<br />
- Der Abschuß des Sperbers (Accipiter nisus) bewirkte<br />
eine Vermehrung des Feldsperlings (Passer montanus)<br />
und dessen Eindringen in das Waldinnere, wo er seinerseits<br />
andere höhlenbrütende Kleinvögel verdrängte.<br />
- Der Abschuß des Habichts (Acclpiter gentilis) kann eine<br />
Zunahme der Rabenkrähe (Corvus corone) zur Folge haben,<br />
die als Eierräuber den Bestand des Kiebitzes (Vanellus<br />
vanellus) schädigen kann.<br />
Welchen Anteil solche indirekten Wirkungen bereits heute<br />
am Rückgang der bedrohten Tierarten haben, ist nicht abschätzbar,<br />
einzelne analysierte Beispiele lassen aber eine<br />
deutlich vermehrte Berücksichtigung solcher Vorgänge im<br />
Rahmen von Naturschutz-Strategien geraten erscheinen.<br />
4.2 Funktionstrennung oder Integration des <strong>Artenschutz</strong>es<br />
in die Landnutzung<br />
Beim derzeitigen Kenntnisstand kann kaµm ein Zweifel daran<br />
bestehen, daß ein statisches, vorwiegend konservierendes<br />
Schutzgebietsystem im herkömmlichen Sinn alleine<br />
den Erfordernissen eines umfassenden, dem gesetzlichen<br />
Auftrag entsprechenden Tierartenschutzes langfristig nicht<br />
gerecht werden kann. Ein auch den tierökologischen Erfordernissen<br />
genügendes Flächensicherungskonzept sollte<br />
deshalb Ober Strategien für eine verstärkte Ausweisung von<br />
Schutzgebieten (eigentliches Biotopschutzkonzept) deutlich<br />
hinausgehen. Es könnte sich im wesentlichen der folgenden<br />
3 Verfahrensweisen bedienen:<br />
- Ausweisung von Schutzgebieten gemäß Naturschutzgesetz<br />
mit differenzierter Festlegung der Schutzziele, artbezogenen<br />
Geboten und Entwicklungszielen.<br />
- Sicherung, Entwicklung und Neuschaffung naturnaher,<br />
ungenutzter Flächen und Objekte in der Kulturlandschaft<br />
in möglichst hoher Dichte.<br />
Aussagen zu den aus <strong>Artenschutz</strong>sicht anzustrebenden<br />
Nutzungsformen für einen erheblichen Teil der derzeitigen<br />
Produktionsfläche der Bundesrepublik Deutschland<br />
und Verwirklichung .Ober im wesentlichen noch zu entwickelnde<br />
Instrumentarien und Handlungsnormen.<br />
Dieses Konzept steht in Einklang sowohl mit den von HA<br />
BER (1971) als auch mit den von ERZ (1980) entwickelten<br />
Vorstellungen Ober eine differenzierte Einflußnahme des<br />
Naturschutzes auf die Entwicklung der gesamten mitteleuropäischen<br />
Landschaft. ßchutzgebiete Im herkömmlichen<br />
Sinn werden in diesem Konzept keineswegs überflüssig,<br />
vielmehr ist eine deutlich verstärkte Ausweisung v.a. von<br />
Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen<br />
für alle jene Tierarten und Gesellschaften unverzichtbar,<br />
die klimaxnahe Vegetationseinheiten in größerer<br />
Ausdehnung besiedeln. Auch für die meisten dieser Arten<br />
wird aber der Wert solcher Schutzgebiete langfristig vom<br />
allgemeinen Zustand der umgebenden Landschaft abhängen.<br />
Über die zweite Verfahrensweise können verstärkt punktuelle<br />
oder lineare Habitate (Kleinbiotope und Saumbiotope im<br />
Sinne von HEYDEMANN 1983) in einem möglichst engen<br />
Netz in der Kulturlandschaft erhalten bzw. neu entwickelt<br />
werden. Bereits verwirklichte Beispiele, v.a. auch solche,<br />
die von Trägern außerhalb des Naturschutzes in die Wege<br />
geleitet wurden (Heckenverpflanzungen durch Flurbereinigung,<br />
Tümpelanlagen durch die Forstverwaltung) belegen<br />
die Umsetzbarkeit dieser Zielvorstellungen in der Praxis.<br />
Eine flankierende Pauschalsicherung weiterer wichtiger Lebensraumtypen<br />
durch Naturschutzrecht, wie sie für einige<br />
Biotoptypen in den Ländergesetzen bereits existiert, würde<br />
diesen Abschnitt eines Flächensicherungskonzeptes für<br />
den Tierartenschutz sinnvoll ergänzen.<br />
Für eine Verwirklichung der Ober die beiden oben diskutierten<br />
Verfahrensweisen erreichbaren Ziele des <strong>Artenschutz</strong>es<br />
626