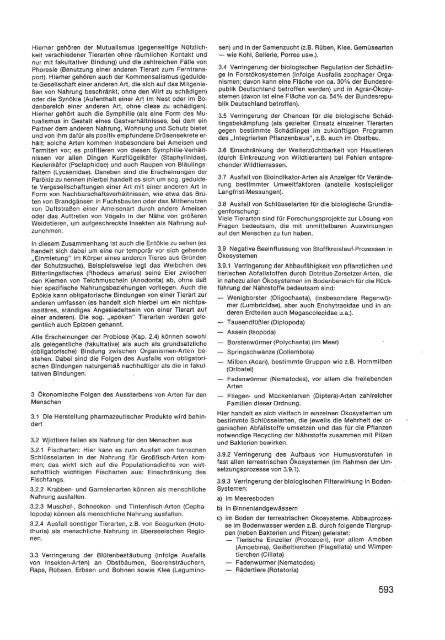Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hierher gehören der Mutualismus (gegenseitige Nützlichkeit<br />
verschiedener Tierarten ohne räumlichen Kontakt und<br />
nur mit fakultativer Bindung) und die zahlreichen Fälle von<br />
Phoresie (Benutzung einer anderen Tierart zum Ferntransport).<br />
Hierher gehören auch der Kommensalismus (geduldete<br />
Gesellschaft einer anderen Art, die sich auf das Mitgenießen<br />
von Nahrung beschränkt, ohne den Wirt zu schädigen)<br />
oder die Synökie (Aufenthalt einer Art im Nest oder im Bodenbereich<br />
einer anderen Art, ohne diese zu schädigen).<br />
Hierher gehört auch die Symphilie (als eine Form des Mutualismus<br />
in Gestalt eines Gastverhältnisses, bei dem ein<br />
Partner dem anderen Nahrung, Wohnung und Schutz bietet<br />
und von ihm dafür als positiv empfundene Drüsensekrete erhält;<br />
solche Arten kommen insbesondere bei Ameisen und<br />
Termiten vor; es profitieren von diesen Symphilie-Verhältnissen<br />
vor allen Dingen Kurzflügelkäfer (Staphylinidae),<br />
Keulenkäfer (Pselaphidae) und auch Raupen von Bläulingsfaltern<br />
(Lycaenidae). Daneben sind die Erscheinungen der<br />
Parökie zu nennen (hierbei handelt es sich um sog. geduldete<br />
Vergesellschaftungen einer Art mit einer anderen Art in<br />
Form von Nachbarschaftsverhältnissen, wie etwa das Brüten<br />
von Brandgänsen in Fuchsbauten oder das Mitbenutzen<br />
von Duftstraßen einer Ameisenart durch andere Ameisen<br />
oder das Auftreten von Vögeln in der Nähe von größeren<br />
Weidetieren, um aufgeschreckte Insekten als Nahrung aufzunehmen.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch die Entökie zu sehen (es<br />
handelt sich dabei um eine nur temporär vor sich gehende<br />
„Einmietung" im Körper eines anderen Tieres aus Gründen<br />
der Schutzsuche). Beispielsweise legt das Weibchen des<br />
Bitterlingsfisches (Rhodeus amarus) seine Eier zwischen<br />
den Kiemen von Teichmuscheln (Anodonta) ab, ohne daß<br />
hier spezifische Nahrungsbeziehungen vorliegen. Auch die<br />
Epökie kann obligatorische Bindungen von einer Tierart zur<br />
anderen umfassen (es handelt sich hierbei um ein nichtparasitäres,<br />
ständiges Angesiedeltsein von einer Tierart auf<br />
einer anderen). Die sog. „ epöken" Tierarten werden gelegentlich<br />
auch Epizoen genannt.<br />
Alle Erscheinungen der Probiose (Kap. 2.4) können sowohl<br />
als gelegentliche (fakultative) als auch als grundsätzliche<br />
(obligatorische) Bindung zwischen Organismen-Arten bestehen.<br />
Dabei sind die Folgen des Ausfalls von obligatorischen<br />
Bindungen naturgemäß nachhaltiger als die in fakultativen<br />
Bindungen.<br />
3 Ökonomische Folgen des Aussterbens von Arten für den<br />
Menschen<br />
3.1 Die Herstellung pharmazeutischer Produkte wird behindert<br />
3.2 W,ildtiere fallen als Nahrung für den l\Aenschen aus<br />
3.2.1 Fischarten: Hier kann es zum Ausfall von tierischen<br />
Schlüsselarten in der Nahrung für Großfisch-Arten kommen;<br />
das wirkt sich auf die Populationsdichte von wirtschaftlich<br />
wichtigen Fischarten aus: Einschränkung des<br />
Fischfangs.<br />
3.2.2 Krabben- und Garnelenarten können als menschliche<br />
Nahrung ausfallen.<br />
3,2.3 Muschel-, Schnecken- und Tintenfisch-Arten (Cephalopoda)<br />
können als menschliche Nahrung ausfallen.<br />
3.2.4 Ausfall sonstiger Tierarten, z.B. von Seegurken (Holo·<br />
thuria) als menschliche Nahrung in überseeischen Regio·<br />
nen.<br />
3.3 Verringerung der Blütenbestäubung (infolge Ausfalls<br />
von Insekten-Arten) an Obstbäumen, Beerensträuchern,<br />
Raps, Rübsen, Erbsen und Bohnen sowie Klee (Leguminosen)<br />
und in der Samenzucht (z.B. Rüben, Klee, Gemüsearten<br />
- wie Kohl, Sellerie, Porree usw.).<br />
3.4 Verringerung der biologischen Regulation der Schädlinge<br />
in Forstökosystemen (infolge Ausfalls zoophager Organismen;<br />
davon kann eine Fläche von ca. 30% der Bundesrepublik<br />
Deutschland betroffen werden) und in Agrar-Ökosystemen<br />
(davon ist eine Fläche von ca. 54% der Bundesrepublik<br />
Deutschland betroffen).<br />
3.5 Verringerung der Chancen für die biologische Schädlingsbekämpfung<br />
(als gezielter Einsatz einzelner Tierarten<br />
gegen bestimmte Schädlinge) im zukünftigen Programm<br />
des „ Integrierten Pflanzenbaus", z.B. auch im Obstbau.<br />
3.6 Einschränkung der Weiterzüchtbarkeit von Haustieren<br />
(durch Einkreuzung von Wildtierarten) bei Fehlen entsprechender<br />
Wildtierrassen.<br />
3.7 Ausfall von Bioindikator-Arten als Anzeiger für Verände·<br />
rung bestimmter Umweltfaktoren (anstelle kostspieliger<br />
Langfrist-Messungen).<br />
3.8 Ausfall von Schlüsselarten für die biologische Grundlagenforschung:<br />
Viele Tierarten sind für Forschungsprojekte zur Lösung von<br />
Fragen bedeutsam, die mit unmittelbaren Auswirkungen<br />
auf den Menschen zu tun haben.<br />
3.9 Negative Beeinflussung von Stoffkreislauf-Prozessen in<br />
Ökosystemen<br />
3.9.1 Verringerung der Abbaufähigkeit von pflanzlichen und<br />
tierischen Abfallstoffen durch Detritus-Zersetzer-Arten, die<br />
in nahezu allen Ökosystemen im Bodenbereich für die Rückführung<br />
der Nährstoffe bedeutsam sind:<br />
- Wenigborster (Oligochaeta), (insbesondere Regenwür·<br />
mer (Lumbricidae), aber auch Enchytraeidae und in anderen<br />
Erdteilen auch Megascolecidae u.a.).<br />
Tausend!üBler (Diplopoda)<br />
Asseln (lsopoda)<br />
Borstenwürmer (Polychaeta) (im Meer)<br />
Springschwänze (Collembola)<br />
Milben (Acari), bestimmte Gruppen wie z.B. Hornmilben<br />
(Oribatei)<br />
- Fadenwürmer (Nematodes), vor allem die freilebenden<br />
Arten<br />
- Fliegen- und Mückenlarven (Diptera)-Arten zahlreicher<br />
Familien dieser Ordnung.<br />
Hier handelt es sich vielfach in einzelnen Ökosystemen um<br />
bestimmte Schlüsselarten, die jeweils die Mehrheit der organischen<br />
Abfallstoffe umsetzen und das für die Pflanzen<br />
notwendige Recycling der Nährstoffe zusammen mit Pilzen<br />
und Bakterien bewirken.<br />
3.9.2 Verringerung des Aufbaus von Humusvorstufen in<br />
fast allen terrestrischen Ökosystemen (im Rahmen der Umsetzungsprozesse<br />
von 3.9.1).<br />
3.9.3 Verringerung der biologischen Filterwirkung in Boden<br />
Systemen:<br />
a) im Meeresboden<br />
b) in Binnenlandgewässern<br />
c) im Boden der terrestrischen Ökosysteme. Abbauprozesse<br />
im Bodenwasser werden z.B. durch folgende Tiergruppen<br />
(neben Bakterien und Pilzen) geleistet:<br />
- Tierische Einzeller (Protozoen), (vor allem Amöben<br />
(Amoebina), Geißeltierchen (Flagellata) und Wimpertierchen<br />
(Ciliata)<br />
Fadenwürmer (Nematodes)<br />
Rädertiere (Rotatoria)<br />
593