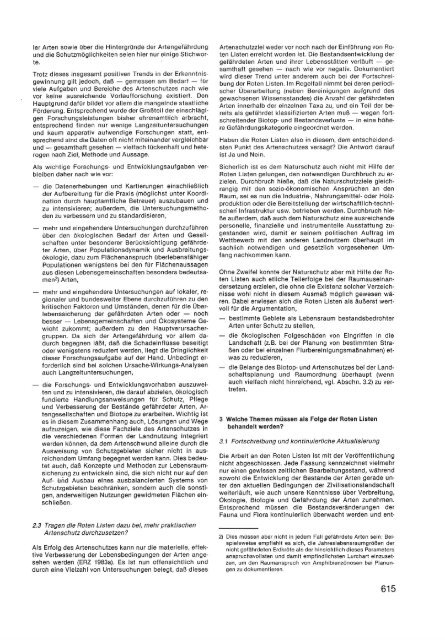Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ler Arten sowie über die Hintergründe der Artenge.fährdung<br />
und die Schutzmöglichkeiten seien hier nur einige Stichwor·<br />
te.<br />
Trotz dieses insgesamt positiven Trends in der Erkenntnis·<br />
gewinnung gilt jedoch, daß - gemessen am Bedarf - für<br />
viele Aufgaben und Bereiche des <strong>Artenschutz</strong>es nach wie<br />
vor keine ausreichende Vorlaufforschung existiert. Den<br />
Hauptgrund dafür bildet vor allem die mangelnde staatliche<br />
Förderung. Entsprechend wurde der Großteil der einschlägi·<br />
gen Forschungsleistungen bisher ehrenamtlich erbracht,<br />
entsprechend finden nur wenige Langzeituntersuchungen<br />
und kaum apparativ aufwendige Forschungen statt, entsprechend<br />
sind die Daten oft nicht miteinander vergleichbar<br />
und - gesamthaft gesehen - vielfach lückenhaft und hete·<br />
rogen nach Ziel, Methode und Aussage.<br />
Als wichtige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben ver·<br />
bleiben daher nach wie vor:<br />
- die Datenerhebungen und Kartierungen einschließlich<br />
der Aufbereitung für die Praxis (möglichst unter Koordi·<br />
nation durch hauptamtliche Betreuer) auszubauen und<br />
zu intensivieren; außerdem, die Untersuchungsmetho·<br />
den zu verbessern und zu standardisieren,<br />
- mehr und eingehendere Untersuchungen durchzuführen<br />
über den ökologischen Bedarf der Arten und Gesell·<br />
schatten unter besonderer Berücksichtigung gefährde·<br />
ter Arten, über Populationsdynamik und Ausbreitungsökologie,<br />
dazu zum Flächenanspruch überlebensfähiger<br />
Populationen wenigstens bei den für Flächenaussagen<br />
aus diesen Lebensgemeinschaften besonders bedeutsamen2)<br />
Arten,<br />
mehr und eingehendere Untersuchungen auf lokaler, re·<br />
gionaler und bundesweiter Ebene durchzuführen zu den<br />
kritischen Faktoren und Umständen, denen für die Über·<br />
lebenssicherung der gefährdeten Arten oder - noch<br />
besser - Lebensgemeinschaften und Ökosysteme Gewicht<br />
zukommt; außerdem zu den Hauptverursachergruppen.<br />
Da sich der Artengefährdung vor allem dadurch<br />
begegnen läßt, daß die Schadeinflüsse beseitigt<br />
oder wenigstens reduziert werden, liegt die Dringlichkeit<br />
dieser Forschungsaufgabe au f der Hand. Unbedingt erforderlich<br />
sind bei solchen Ursache-Wirkungs-Analysen<br />
auch Langzeituntersuchungen,<br />
- die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auszuweiten<br />
und zu intensivieren, die darauf abzielen, ökologisch<br />
fundierte Handlungsanweisungen für Schutz, Pflege<br />
und Verbesserung der Bestände gefährdeter Arten, Artengesellschaften<br />
und Biotope zu erarbeiten. Wichtig ist<br />
es in diesem Zusammenhang auch, Lösungen und Wege<br />
aufzuzeigen, wie diese Fachziele des <strong>Artenschutz</strong>es in<br />
die verschiedenen Formen der Landnutzung integriert<br />
werden können, da dem Artenschwund alleine durch die<br />
Ausweisung von Schutzgebieten sicher nicht in aus·<br />
reichendem Umfang begegnet werden kann. Dies bedeu·<br />
tet auch, daß Konzepte und Methoden zur Lebensraum·<br />
sicherung zu entwickeln sind, die sich nicht nur auf den<br />
Auf· f.Jnd Ausbau eines ausbalancierten Systems von<br />
Schutzgebieten beschränken, sondern auch die sonstigen,<br />
anderweitigen Nutzungen gewidmeten Flächen ein·<br />
schließen.<br />
2.3 Tragen die Roten Listen dazu bei, mehr praktischen<br />
<strong>Artenschutz</strong> durchzusetzen?<br />
Als Erfolg des <strong>Artenschutz</strong>es kann nur die materielle, effektive<br />
Verbesserung der Lebensbedingungen der Arten ange·<br />
sehen werden (ERZ 1983a). Es ist nun offensichtlich und<br />
durch eine Vielzahl von Untersuchungen belegt, daß dieses<br />
<strong>Artenschutz</strong>ziel weder vor noch nach der Einführung von Ro·<br />
ten Listen erreicht worden ist. Die Bestandsentwicklung der<br />
gefährdeten Arten und ihrer Lebensstätten verläuft - gesamthaft<br />
gesehen - nach wie vor negativ. Dokumentiert<br />
wird dieser Trend unter anderem auch bei der Fortschreibung<br />
der Roten Listen. Im Regelfall nimmt bei deren periodischer<br />
Überarbeitung (neben Bereinigungen aufgrund des<br />
gewachsenen Wissensstandes) die Anzahl der gefährdeten<br />
Arten innerhalb der einzelnen Taxa zu, und ein Teil der bereits<br />
als gefährdet klassifizierten Arten muß - wegen fort·<br />
schreitender Biotop· und Bestandsverluste - in eine höhere<br />
Gefährdungskategorie eingeordnet werden.<br />
Haben die Roten Listen also in diesem, dem entscheidendsten<br />
Punkt des <strong>Artenschutz</strong>es versagt? Die Antwort darauf<br />
ist Ja und Nein.<br />
Sicherlich ist es dem Naturschutz auch nicht mit Hilfe der<br />
Roten Listen gelungen, den notwendigen Durchbruch zu erzielen.<br />
Durchbruch hieße, daß die Naturschutzziele gleichrangig<br />
mit den sozio-ökonomischen Ansprüchen an den<br />
Raum, sei es nun die Industrie-, Nahrungsmittel· oder Holzproduktion<br />
oder die Bereitstellung der wirtschaftlich-technischen<br />
Infrastruktur usw. betrieben werden. Durchbruch hieße<br />
außerdem, daß auch dem Naturschutz eine ausreichende<br />
personelle, finanzielle und instrumentelle ·Ausstattung zugestanden<br />
wird, damit er seinem politischen Auftrag im<br />
Wettbewerb mit den anderen Landnutzern überhaupt im<br />
sachlich notwendigen und gesetzlich vorgesehenen Umfang<br />
nachkommen kann.<br />
Ohne Zweifel konnte der Naturschutz aber mit Hilfe der Roten<br />
Listen auch etliche Teilerfolge bei der Raumauseinandersetzung<br />
erzielen, die ohne die Existenz solcher Verzeich·<br />
nisse wohl nicht in diesem Ausmaß möglich gewesen wären.<br />
Dabei erwiesen sich die Roten Listen als äußerst wert·<br />
voll für die Argumentation,<br />
- bestimmte Gebiete als Lebensraum bestandsbedrohter<br />
Arten unter Schutz zu stellen,<br />
die ökologischen Folgeschäden von Eingriffen in die<br />
Landschaft (z.B. bei der Planung von bestimmten Stra·<br />
ßen oder bei einzelnen Flurbereinigungsmaßnahmen) et·<br />
was zu reduzieren,<br />
- die Belange des Biotop- und <strong>Artenschutz</strong>es bei der Landschaftsplanung<br />
und Raumordnung überhaupt (wenn<br />
auch vielfach nicht hinreichend, vgl. Abschn. 3.2) zu vertreten.<br />
3 Welche Themen müssen als Folge der Roten Listen<br />
behandelt werden?<br />
3. 1 Fortschreibung und kontinuierliche Aktualisierung<br />
Die Arbeit an den Roten Listen ist mit der Veröffentlichung<br />
nicht abgeschlossen. Jede Fassung kennzeichnet vielmehr<br />
nur einen gewissen zeitlichen Bearbeitungsstand, während<br />
sowohl die Entwicklung der Bestände der Arten gerade unter<br />
den aktuellen Bedingungen der Zivilisationslandschaft<br />
weiterläuft, wie auch unsere Kenntnisse über Verbreitung,<br />
Ökologie, Biologie und Gefährdung der Arten zunehmen.<br />
Entsprechend müssen die Bestandsveränderungen der<br />
Fauna und Flora kontinuierlich überwacht werden und ent·<br />
2) Dies müssen aber nicht in jedem Fall gefährdete Arten sein: Bei·<br />
spielsweise empfiehlt es sich, die Jahreslebensraumgrößen der<br />
nicht gefährdeten Erdkröte als der hinsichtlich dieses Paramet ers<br />
anspruchsvollsten und damit empfindlichsten Lurchart einzusetzen,<br />
um den Raumanspruch von Amphibienzönosen bei Planungen<br />
zu dokumentieren.<br />
615