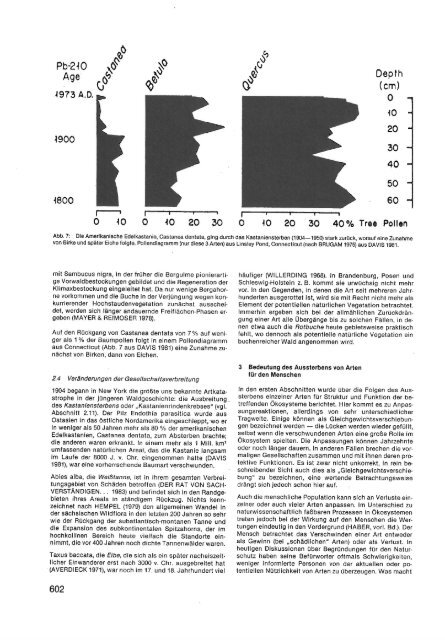Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pb-2~0<br />
Age·<br />
A973 A.D.<br />
~900<br />
~800<br />
~o<br />
o~<br />
~<br />
\Jo<br />
~o 0 ~o 20 30 0 ~o 20 · 30<br />
Depth<br />
(cm)<br />
0<br />
iO<br />
20<br />
30<br />
40<br />
50<br />
60<br />
40 % Tree Pollen<br />
Abb. 7: Die Amerikanische Edelkastanie, Castanea dentata, ging durch das Kastaniensterben (1904-1950) stark zurück, worauf eine Zunahme<br />
von Birke und später Elche folgte. Pollendiagramm (nur diese 3 Arten) aus Linsley Pond, Connecticut (nach BRUGAM 1975) aus DAVIS 1981.<br />
mit Sambucus nigra, in der früher die Bergulme pionierartige<br />
Vorwaldbestockungen gebildet und die Regeneration der<br />
Klimaxbestockung eingeleitet hat. Da nur wenige Bergahorne<br />
vorkommen und die Buche in der Verjüngung wegen konkurrierender<br />
Hochstaudenvegetation zunächst ausscheidet,<br />
werden sich länger andauernde Freiflächen-Phasen ergeben<br />
(MAYER & REIMOSER 1978).<br />
Auf den Rückgang von Castanea dentata von 7 % auf weniger<br />
als 1 % der Baumpo llen folgt in einem Pollendiagramm<br />
aus Connecticut (Abb. 7 aus DAVIS 1981) eine Zunahme zunächst<br />
von Birken, dann von Eichen.<br />
2.4 Veränderungen der Gesellschaftsverbreitung<br />
1904 begann in New York die größte uns bekannte Artkatast<br />
rophe in der jüngeren Waldgeschichte: die Ausbreitung .<br />
des Kastaniensterbens oder „ Kastanienrindenkrebses" (vgl.<br />
Abschnitt 2.11 ). Der Pilz Endothia parasitica wurde aus<br />
Ostasien in das östliche Nordamerika eingeschleppt, wo er<br />
in weniger als 50 Jahren mehr als 80 % der amerikanischen<br />
Edelkastanien, Castanea dentata, zum Absterben brachte;<br />
die anderen waren erkrankt. In einem mehr als 1 Mill. km 2<br />
umfassenden natürlichen Areal, das die Kastanie langsam<br />
im laufe der 8000 J. v. Chr. eingenommen hatte (DAVIS<br />
1981), war eine vorherrschende Baumart verschwunden.<br />
Abies alba, die Weißtanne, ist in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet<br />
von Schäden betroffen (DER RAT VON SACH<br />
VERSTÄNDIGEN ... 1983) und befindet sich in den Randgebieten<br />
ihres Areals in ständigem Rückzug. Nichts kennzeichnet<br />
nach HEMPEL (1979) den allgemeinen Wandel in<br />
der sächsischen Wildflora in den letzten 200 Jahren so sehr<br />
wie der Rückgang der subatlantisch-montanen Tanne und<br />
die Expansion des subkontinentalen Spitzahorns, der im<br />
hochkollinen Bereich heute vielfach die Standorte einnimmt,<br />
die vor 400 Jahren noch dichte Tannenwälder waren.<br />
Taxus baccata, die Eibe, die sich als ein später nacheiszeitlicher<br />
Einwanderer erst nach 3000 v. Chr. ausgebreitet hat<br />
(AVERDIECK 1971), war noch im 17. und 18. Jahrhundert viel<br />
häufiger (WILLERDING 1968). In Brandenbu rg, Posen und<br />
Schleswig-Holstein z. B. kommt sie urwüchsig nicht meh r<br />
vor. In den Gegenden, In denen die Art seit mehreren Jahrhunderten<br />
ausgerottet ist, wird sie mit Recht nicht mehr als<br />
Element der potentiellen natürlichen Vegetation betrachtet.<br />
Immerhin ergeben sich bei der allmählichen Zurückdrängung<br />
einer Art alle Übergänge bis zu solchen Fällen, in denen<br />
etwa auch die Rotbuche heute gebietsweise praktisch<br />
fehlt, wo dennoch als potentielle natürliche Vegetation ein<br />
buchen reicher Wald angenommen wird.<br />
3 Bedeutung des Aussterbens von Arten<br />
für den Menschen<br />
In den ersten Abschnitten wurde über die Folgen des Aussterbens<br />
einzelner Arten für Struktur und Funktion der betreffenden<br />
Ökosysteme berichtet. Hier kommt es zu Anpassungsreaktionen,<br />
allerdings von sehr unterschiedlicher<br />
Tragweite. Einige können als Gleichgewichtsverschiebungen<br />
bezeichn.et werd en - die Lücken werden wieder gefüllt,<br />
selbst wenn die verschwundenen Arten eine große Rolle im<br />
Ökosystem spielten.' Die Anpassungen können Jahrzehnte<br />
oder noch länger dauern. In anderen Fällen brechen die vormaligen<br />
Gesellschaften zusammen und mit ihnen deren protektive<br />
Funktionen. Es ist zwar nicht un korrekt, in rein beschreibender<br />
Sicht auch dies als „Gleichgewichtsverschiebung"<br />
zu bezeichnen, eine wertende Bet rachtungsweise<br />
drängt sich jedoch schon hier auf.<br />
Auch die menschliche Population kann sich an Verluste einzelner<br />
oder auch vieler Arten anpassen. Im Unterschied zu<br />
naturwissenschaftlich faßbaren Prozessen in Ökosystemen<br />
treten jedoch bei der Wi rkung auf den Menschen die Wertungen<br />
eindeutig in den Vordergru nd (HABER, vorl. Bd.). Der<br />
Mensch betrachtet das Verschwinden einer Art entweder<br />
als Gewinn (bei „schädlichen" Arten) oder als Verlust. In<br />
heutigen Diskussionen Ober Begründungen für den Naturschutz<br />
haben seine Befürworter oftmals Schwierigkeiten,<br />
weniger informierte Personen von der aktuellen oder potentiellen<br />
Nützlichkeit von Arten zu überzeugen. Was macht<br />
602