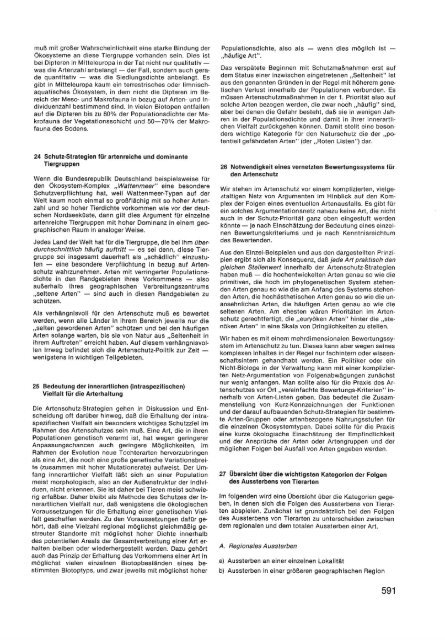Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
muß mit großer Wahrscheinlichkeit eine starke Bindung der<br />
Ökosysteme an diese Tiergruppe vorhanden sein. Dies ist<br />
bei Dipteren in Mitteleuropa in der Tat nicht nur qualitativ -<br />
was die Artenzahl anbelangt - der Fall, sondern auch gera·<br />
de quantitativ - was die Siedlungsdichte anbelangt. Es<br />
gibt in Mitteleuropa kaum ein terrestrisches oder limnisch·<br />
aquatisches Ökosystem, in dem nicht die Dipteren im Bereich<br />
der Meso· und Makrofauna in bezug auf Arten- und Jndividuenzahl<br />
bestimmend sind. In vielen Biotopen entfallen<br />
auf die Dipteren bis zu 80% der Populatio.nsdichte der Makrofauna<br />
der Vegetationsschicht und 50-70% der Makro·<br />
fauna des Bodens.<br />
24 Schutz-Strategien für artenreiche und dominante<br />
Tiergruppen<br />
Wenn die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise für<br />
den Ökosystem-Komplex „ Wattenmeer" eine besondere<br />
Schutzverpflichtung hat, weil Wattenmeer-Typen auf der<br />
Welt kaum noch einmal so großflächig mit so hoher Arten·<br />
zahl und so hoher Tierdichte vorkommen wie vor der deutschen<br />
Nordseeküste, dann gilt dies Argument für einzelne<br />
artenreiche Tiergruppen mit hoher Dominanz in einem geographischen<br />
Raum in analoger Weise.<br />
Jedes Land der Welt hat für die Tiergruppe, die bei ihm überdurchschnittlich<br />
häufig auftritt - es sei denn, diese Tiergruppe<br />
sei insgesamt dauerhaft als „schädlich" einzustufen<br />
- eine besondere Verpflichtung in bezug auf <strong>Artenschutz</strong><br />
wahrzunehmen. Arten mit verringerter Populationsdichte<br />
in den Randgebieten ihres Vorkommens - also<br />
außerhalb ihres geographischen Verbreitungszentrums<br />
„seltene Arten" - sind auch in diesen Randgebieten zu<br />
schützen.<br />
Als verhängnisvoll für den <strong>Artenschutz</strong> muß es bewertet<br />
werden, wenn alle Länder in ihrem Bereich jeweils nur die<br />
„selten gewordenen Arten" schützen und bei den häufigen<br />
Arten solange warten, bis sie von Natur aus „Seltenheit in<br />
ihrem Auftreten" erreicht haben. Auf diesem verhängnisvol·<br />
Jen Irrweg befindet sich die <strong>Artenschutz</strong>-Politik zur Zeit -<br />
wenigstens in wichtigen Teilgebieten.<br />
25 Bedeutung der innerartlichen (intraspezifischen)<br />
Vielfalt für die Arterhaltung<br />
Die <strong>Artenschutz</strong>-Strategien gehen in Diskussion und Entscheidung<br />
oft darüber hinweg, daß die Erhaltung der intraspezifischen<br />
Vielfalt ein besonders wichtiges Schutzziel im<br />
Rahmen des <strong>Artenschutz</strong>es sein muß. Eine Art, die in ihren<br />
Populationen genetisch verarmt ist, hat wegen geringerer<br />
Anpassungschancen auch geringere Möglichkeiten, im<br />
Rahmen der Evolution neue Tochterarten hervorzubringen<br />
als eine Art, die noch eine große genetische Variationsbreite<br />
(zusammen mit hoher Mutationsrate) aufweist. Der Um·<br />
fang innerartlicher Vielfalt läßt sich an einer Population<br />
meist morphologisch, also an der Außenstruktur der Individuen,<br />
nicht erkennen. Sie ist daher bei Tieren meist schwierig<br />
erfaßbar. Daher bleibt als Methode des Schutzes der in·<br />
nerartlichen Vielfalt nur, daß wenigstens die ökologischen<br />
Voraussetzungen für die Erhaltung einer genetischen Viel·<br />
falt geschaffen werden. Zu den Voraussetzungen dafür ge·<br />
hört, daß eine Vielzahl regional möglichst gleichmäßig gestreuter<br />
Standorte mit möglichst hoher Dichte innerhalb<br />
des potentiellen Areals der Gesamtverbreitung einer Art erhalten<br />
bleiben oder wiederhergestellt werden. Dazu gehört<br />
auch das Prinzip der Erhaltung des Vorkommens einer Art in<br />
möglichst vielen einzelnen Biotopbeständen eines be·<br />
stimmten Biotoptyps, und zwar jeweils mit möglichst hoher<br />
Populationsdichte, also als - wenn dies möglich ist -<br />
„häufige Art".<br />
Das verspätete Beginnen mit Schutzmaßnahmen erst auf<br />
dem Status einer inzwischen eingetretenen „ Seltenheit" ist<br />
aus den genannten Gründen in der Regel mit höherem genetischen<br />
Verlust innerhalb der Populationen verbunden. Es<br />
müssen <strong>Artenschutz</strong>maßnahmen in der 1. Priorität also auf<br />
solche Arten bezogen werden, die zwar noch „häufig" sind,<br />
aber bei denen die Gefahr besteht, daß sie in wenigen Jahren<br />
in der Populationsdichte und damit in ihrer innerartlichen<br />
Vielfalt zurückgehen können. Damit stellt eine beson·<br />
ders wichtige Kategorie für den Naturschutz die der „potentiell<br />
gefährdeten Arten" (der „Roten Listen") dar.<br />
26 Notwendigkeit eines vernetzten Bewertungssystems für.<br />
den <strong>Artenschutz</strong><br />
Wir stehen im <strong>Artenschutz</strong> vor einem komplizierten, vielge·<br />
3taltigen Netz von Argumenten im Hinblick auf den Korn·<br />
plex der Folgen eines eventuellen Artenausfalls. Es gibt für<br />
ein solches Argumentationsnetz nahezu keine Art, die nicht<br />
auch in der Schutz-Priorität ganz oben eingestuft werden<br />
könnte - je nach Einschätzung der Bedeutung eines einzel·<br />
nen Bewertungskriteriums und je nach Kenntnisreichtum<br />
des Bewertenden.<br />
Aus den Einzel-Beispielen und aus den dargestellten Prinzipien<br />
ergibt sich als Konsequenz, daß jede Art praktisch den<br />
gleichen Stellenwert innerhalb der <strong>Artenschutz</strong>-Strategien<br />
haben muß - die hochentwickelten Arten genau so wie die<br />
primitiven, die hoch im phylogenetischen System stehen·<br />
den Arten genau so wie die am Anfang des Systems stehen·<br />
den Arten, die hochästhetischen Arten genau so wie die unansehnlichen<br />
Arten, die häufigen Arten genau so wie die<br />
seltenen Arten. Am ehesten wären Prioritäten im <strong>Artenschutz</strong><br />
gerechtfertigt, die „euryöken Arten" hinter die „stenöken<br />
Arten" in eine Skala von Dringlichkeiten zu stellen.<br />
Wir haben es mit einem mehrdimensionalen Bewertungssystem<br />
im <strong>Artenschutz</strong> zu tun. Dieses kann aber wegen seines<br />
komplexen Inhaltes in der Regel nur fach intern oder wissenschaftsintern<br />
gehandhabt werden. Ein Politiker oder ein<br />
Nicht-Biologe in der Verwaltung kann mit einer komplizier·<br />
ten Netz-Argumentation von Folgenabwägungen zunächst<br />
nur wenig anfangen. Man sollte also für die Praxis des Ar·<br />
tenschutzes vor Ort „vereinfachte Bewertungs-Kriterien" innerhalb<br />
von Arten-Listen geben. Das bedeutet die Zusam·<br />
menstellung von Kurz-Kennzeichnungen der Funktionen<br />
und der darauf aufbauenden Schutz-Strategien für bestimmte<br />
Arten-Gruppen oder artenbezogene Nahrungsstufen für<br />
die einzelnen Ökosystemtypen. Dabei sollte für die Praxis<br />
eine kurze ökologische Einschätzung der Empfindlichkeit<br />
und der Ansprüche der Arten oder Artengruppen und der<br />
möglichen Folgen bei Ausfall von Arten gegeben werden.<br />
27 Übersicht über die wichtigsten Kategorien der Folgen<br />
des Aussterbens von Tierarten<br />
Im folgenden wird eine Übersicht Ober die Kategorien gegeben,<br />
in denen sich die Folgen des Aussterbens von Tierar·<br />
ten abspielen. Zunächst ist grundsätzlich bei den Folgen<br />
des Aussterbens von Tierarten zu unterscheiden zwischen<br />
dem regionalen und dem totalen Aussterben einer Art.<br />
A. Regionales Aussterben<br />
a) Aussterben an einer einzelnen Lokalität<br />
b) Aussterben In einer größeren geographischen Region<br />
591