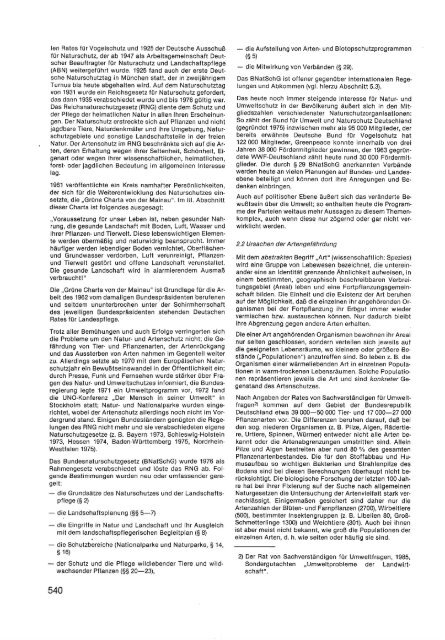Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
len <strong>Rat</strong>es für Vogelschutz und 1925 der Deutsche Ausschuß<br />
für Naturschutz, der ab 1947 als Arbeitsgemeinschaft <strong>Deutscher</strong><br />
Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(ABN) weitergeführt wurde. 1925 fand auch der erste Deutsche<br />
Naturschutztag in München statt, der in zweijährigem<br />
Turnus bis heute abgehalten wird. Auf dem Naturschutztag<br />
von 1931 wurde ein Reichsgesetz für Naturschutz gefordert,<br />
das dann 1935 verabschiedet wurde und bis 1976 gültig war.<br />
Das Reichsnaturschutzgesetz (RNG) diente dem Schutz und<br />
der Pflege der heimatlichen Natur in allen ihren Erscheinungen.<br />
Der Naturschutz erstreckte sich auf Pflanzen und nicht<br />
jagdbare Tiere, Naturdenkmäler und ihre Umgebung, Naturschutzgebiete<br />
und sonstige Landschaftsteile in der freien<br />
Natur. Der <strong>Artenschutz</strong> im RNG beschränkte sich auf die Arten,<br />
deren Erhaltung wegen ihrer Seltenheit, Schönheit, Ei·<br />
genart oder wegen ihrer wissenschaftlichen, heimatlichen,<br />
forst- oder jagdlichen Bedeutung im allgemeinen Interesse<br />
lag.<br />
1961 veröffentlichte ein Kreis namhafter Persönlichkeiten,<br />
der sich für die Weiterentwicklung des Naturschutzes einsetzte,<br />
die „Grüne Charta von der Mainau". Im III. Abschnitt<br />
dieser Charta ist folgendes ausgesagt:<br />
„Voraussetzung für unser Leben ist, neben gesunder Nahrung,<br />
die gesunde Landschaft mit Boden, Luft, Wasser und<br />
ihrer Pflanzen- und Tierwelt. Diese lebenswichtigen Elemente<br />
werden übermäßig und naturwidrig beansprucht. Immer<br />
häufiger werden lebendiger Boden vernichtet, Ob_erfläGhenund<br />
Grundwasser verdorben, Luft verunreinigt, Pflanzenund<br />
Tierwelt gestört und offene Landschaft verunstaltet.<br />
Die gesunde Landschaft wird in alarmierendem Ausmaß<br />
verbraucht!"<br />
Die „Grüne Charta von der Mainau" ist Grundlage für die Arbeit<br />
des 1962 vom damaligen Bundespräsidenten berufenen<br />
und seitdem ununterbrochen unter der Schirmherrschaft<br />
des jeweiligen Bundespräsidenten stehenden Deutschen<br />
<strong>Rat</strong>es für <strong>Landespflege</strong>.<br />
Trotz aller Bemühungen und auch Erfolge verringerten sich<br />
die Probleme um den Natur· und <strong>Artenschutz</strong> nicht; die Gefährdung<br />
von Tier- und Pflanzenarten, der Artenrückgang<br />
und das Aussterben von Arten nahmen im Gegenteil weiter<br />
zu. Allerdings setzte ab 1970 mit dem Europäischen Naturschutzjahr<br />
ein Bewußtseinswandel in der Öffentlichkeit ein;<br />
durch Presse, Funk und Fernsehen wurde stärker über Fragen<br />
des Natur- und Umweltschutzes informiert, die Bundesregierung<br />
legte 1971 ein Umweltprogramm vor, 1972 fand<br />
die UNO-Konferenz „Der Mensch in seiner Umwelt" in<br />
Stockholm statt; Natur- und Nationalparke wurden eingerichtet,<br />
wobei der <strong>Artenschutz</strong> allerdings noch nicht im Vordergrund<br />
stand. Einigen Bundesländern genügten die Regelungen<br />
des RNG nicht mehr und sie verabschiedeten eigene<br />
Naturschutzgesetze (z. B. Bayern 1973, Schleswig-Holstein<br />
1973, Hessen 1974, Baden-Württemberg 1975, Nordrhein<br />
Westfalen 1975).<br />
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde 1976 als<br />
Rahmengesetz verabschiedet und löste das RNG ab. Fol·<br />
gende Bestimmungen wurden neu oder umfassender geregelt:<br />
- die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts·<br />
pflege(§ 2)<br />
- die Landschaftsplanung(§§ 5-7)<br />
- die Eingriffe in Natur und Landschaft und ihr Ausgleich<br />
mit dem landschaftspflegerischen Begleitplan (§ 8)<br />
- die Schutzbereiche (Nationalparke und Naturparke, § 14,<br />
§ 16)<br />
- der Schutz und die Pflege wildlebender Tiere und wild·<br />
wachsender Pflanzen (§§ 20- 23),<br />
- die Aufstellung von Arten- und Biotopschutzprogrammen<br />
(§ 5)<br />
- die Mitwirkung von Verbänden (§ 29).<br />
Das BNatSchG ist offener gegenüber internationalen Regelungen<br />
und Abkommen (vgl. hierzu Abschnitt 5.3).<br />
Das heute noch immer steigende Interesse für Natur- und<br />
Umweltschutz in der Bevölkerung äußert sich in den Mit·<br />
gliedszahlen verschiedenster Naturschutzorganisationen:<br />
So zählt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland<br />
(gegründet 1975) inzwischen mehr als 95 000 Mitglieder, der<br />
bereits erwähnte Deutsche Bund für Vogelschutz hat<br />
122 000 Mitglieder, Greenpeace konnte innerhalb von drei<br />
Jahren 38 000 Fördermitglieder gewinnen, der 1963 gegründete<br />
WWF-Deutschland zählt heute rund 30 000 Fördermit·<br />
glieder. Die durch § 29 BNatSchG anerkannten Verbände<br />
werden heute an vielen Planungen auf Bundes- und Landesebene<br />
beteiligt und können dort ihre Anregungen und Bedenken<br />
einbringen.<br />
Auch auf politischer Ebene äußert sich das veränderte Bewußtsein<br />
Ober die Umwelt; so enthalten heute die Programme<br />
der Parteien weitaus mehr Aussagen zu diesem Themenkomplex,<br />
auch wenn diese nur zögernd oder gar nicht verwirklicht<br />
werden.<br />
2.2 Ursachen der Artengefährdung<br />
· Mit dem abstrakten Begriff „Art" (wissenschaftlich: Spezies)<br />
wird eine Gruppe von Lebewesen bezeichnet, die unterein·<br />
ander eine an Identität grenzende Ähnlichkeit aufweisen, in<br />
einem bestimmten, geographisch beschreibbaren Verbreitungsgebiet<br />
(Areal) leben und eine Fortpflanzungsgemein·<br />
schaft bilden. Die Einheit und die Existenz der Art beruhen<br />
auf der Möglichkeit, daß die einzelnen ihr angehörenden Organismen<br />
bei der Fortpflanzung ihr Erbgut immer wieder<br />
vermischen bzw. austauschen können. Nur dadurch bleibt<br />
ihre Abgrenzung gegen andere Arten erhalten.<br />
Die einer Art angehörenden Organismen bewohnen ihr Areal<br />
nur selten geschlossen, sondern verteilen sich jeweils auf<br />
die geeigneten Lebensräume, wo kleinere oder größere Bestände<br />
(„Populationen") anzutreffen sind. So leben z. B. die<br />
Organismen einer wärmeliebenden Art in einzelnen Popu la·<br />
tionen in warm-trockenen Lebensräumen. Solche Populationen<br />
repräsentieren jeweils die Art und sind konkreter Gegenstand<br />
des <strong>Artenschutz</strong>es.<br />
Nach Angaben der <strong>Rat</strong>es von Sachverständigen für Umweltfragen2)<br />
kommen auf dem Gebiet der Bundesrepublik<br />
Deutschland etwa 39 000-50 000 Tier- und 17 000-27 000<br />
Pflanzenarten vor. Die Differenzen beruhen darauf, daß bei<br />
den sog. niederen Organismen (z. B. Pilze, Algen, Rädertie·<br />
re, Urtiere, Spinnen, Würmer) ent weder nicht alle Arten bekannt<br />
oder die Artenabgrenzungen umstritten sind. Allein<br />
Pilze und Algen bestreiten aber rund 80 % des gesamten<br />
Pflanzenartenbestandes. Die für den Stoffabbau und Humusaufbau<br />
so wichtigen Bakterien und Strahlenpilze des<br />
Bodens sind bei diesen Berechnungen Oberhaupt nicht berücksichtigt.<br />
Die biologische Forschung der letzten 100 Jah·<br />
re hat bei ihrer Fixierung auf der Suche nach allgemeinen<br />
Naturgesetzen die Untersuchung der Artenvielfalt stark vernachlässigt.<br />
Einigermaßen gesichert sind daher nur die<br />
Artenzahlen der Blüten- und Farnpflanzen (2700), Wirbeltiere<br />
(500), bestimmter Insektengruppen (z. B. Libellen 80, Groß<br />
Schmetterlinge 1300) und Weichtiere (301). Auch bei ihnen<br />
ist aber meist nicht bekannt, wie groß die Populationen der<br />
einzelnen Arten, d. h. wie selten oder häufig sie sind.<br />
2) Der <strong>Rat</strong> von Sachverständigen für Umweltfragen, 1985,<br />
Sondergutachten „ Umweltprobleme der Landwirtschaft''.<br />
540