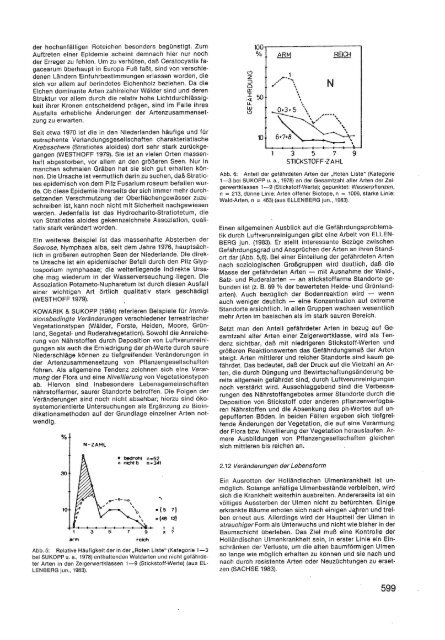Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der hochanfälligen Roteichen besonders begünstigt. Zum<br />
Auftreten einer Epidemie scheint demnach hier nur noch<br />
der Erreger zu fehlen. Um zu verhüten, daß Ceratocystis fagacearum<br />
überhaupt in Europa Fuß faßt, sind von verschiedenen<br />
Ländern Einfuhrbestimmungen erlassen worden, die<br />
sich vor allem auf berindetes Eichenholz beziehen. Da die<br />
Eichen dominante Arten zahlreicher Wälder sind und deren<br />
Struktur vor allem durch die relativ hohe Lichtdurchlässigkeit<br />
ihrer Kronen entscheidend prägen, sind im Falle ihres<br />
Ausfalls erhebliche Änderungen der Artenzusammensetzung<br />
zu erwarten.<br />
Seit etwa 1970 ist die in den Niederlanden häufige und für<br />
eutraphente Verlandungsgesellschaften charakteristische<br />
Krebsschere (Stratiotes aloides) dort sehr stark zurückgegangen<br />
(WESTHOFF 1979). Sie ist an vielen Orten massenhaft<br />
abgestorben, vor allem an den größeren Seen. Nur in<br />
manchen schmalen Gräben hat sie sich gut erhalten kön·<br />
nen. Die Ursache ist vermutlich darin zu suchen, daß Stratiotes<br />
epidemisch von dem Pilz Fusarium roseum befallen wurde.<br />
Ob diese Epidemie ihrerseits der sich immer mehr durchsetzenden<br />
Verschmutzung der Oberflächengewässer zuzuschreiben<br />
ist, kann noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen<br />
werden. Jedenfalls ist das Hydrocharito-Stratiotetum die<br />
von Stratiotes aloides gekennzeichnete Assoziation, ~uali·<br />
tativ stark verändert worden.<br />
Ein weiteres Beispiel ist das massenhafte Absterben der<br />
Seerose, Nymphaea alba, seit dem Jahre 1976, hauptsächlich<br />
in größeren eutrophen Seen der Niederlande. Die direkte<br />
Ursache ist ein epidemischer Befall durch den Pilz Glyptosporium<br />
nymphaeae; die weiterliegende indirekte Ursache<br />
mag wiederum in der Wasserverseuchung .liegen. Die<br />
Assoziation Potameto-Nupharetum ist durch diesen Ausfall<br />
einer wichtigen Art örtlich qualitativ stark geschädigt<br />
(WESTHOFF 1979). .<br />
KOWARIK & SUKOPP (1984) referieren Beispiele für immiss/onsbedingte<br />
Veränderungen verschiedener terrestrischer<br />
Vegetationstypen (Wälder, Forste, Heiden, Moore, Grünland,<br />
Segetal· und Ruderalvegetation). Sowohl die Anreicherung<br />
von Nährstoffen durch Deposition von Luftverunreinigungen<br />
als auch die Erniedrigung der ph-Werte durch saure<br />
Niederschläge können zu tiefgreifenden Veränderungen in<br />
der Artenzusammensetzung von Pflanzengesellschaften<br />
führen. Als allgemeine Tendenz zeichnen sich eine Verarmung<br />
der Flora und eine Nivellierung von Vegetationstypen<br />
ab. Hiervon sind insbesondere Lebensgemeinschaften<br />
nährstoffarmer, saurer Standorte betroffen. Die Folgen der<br />
Veränderungen sind noch nicht absehbar; hierzu sind ökosystemorientierte<br />
Untersuchungen als Ergänzung zu Bioin·<br />
dikatlonsmethoden auf der Grundlage einzelner Arten notwendig.<br />
%<br />
30<br />
arm<br />
N-ZAHL<br />
3 5<br />
• bedroht na52<br />
o nichl b . n • 341<br />
....<br />
•(5<br />
0 (46<br />
7 9<br />
1<br />
X<br />
reich<br />
Abb. 5: Relative Häufigkeit der in der „ Roten Liste" (Kategorie 1-3<br />
bei SUKOPP u. a„ 1978) enthaltenden Waldarten und nicht gefährdeter<br />
Arten In den Zeigerwertklassen 1-9 (Stickstoff-Werte) (aus EL·<br />
LENBERG jun., 1983).<br />
7)<br />
12)<br />
1<br />
7<br />
<br />
z<br />
::)<br />
0<br />
a::<br />
100~-----------.<br />
O/o<br />
... ~-)„.<br />
~, ,\ N<br />
.<br />
' ~ 50 .<br />
u.<br />
l..U<br />
<br />
10<br />
.<br />
', , ....<br />
\,,,„,„ \,<br />
3 5 7 9<br />
STICKSTOFF·ZAHL<br />
Abb. 6: . Anteil der gefährdeten Arten der . Roten Liste" (Kategorie<br />
1-3 bei SUKOPP u. a„ 1978) an der Gesamtzahl aller Arten der Zeigerwertklassen<br />
1 -:- ~ (Stickstoff-Werte); gepunktet: Wasserpflanzen,<br />
n = 213, dünne Linie: Arten offener Biotope, n = 1006, starke Linie:<br />
Wald-Arten, n = 463) (aus ELLEN BERG jun., 1983).<br />
Einen allgemeinen Ausblick auf die Gefährdungsproblematik<br />
durch Luftverunreinigungen gibt eine Arbeit von ELLEN<br />
BERG jun. (1983). Er stellt interessante Bezüge zwischen<br />
Gefährdungsgrad und Ansprüchen der Arten an ihren Standort<br />
dar (Abb. 5,6). Bei einer Einteilung der gefährdeten Arten<br />
nach soziologischen Großgruppen wird deutlich, daß die<br />
Masse der gefährdeten Arten - mit Ausnahme der Wald·<br />
Salz· und Ruderalarten - an stickstoffarme Standorte ge'.<br />
bunden ist (z. B. 69 % der bewerteten Heide· und Grünland·<br />
arten). Auch bezüglich der Bodenreaktion wird - wenn<br />
auch weniger deutlich - eine Konzentration auf extreme<br />
Standorte ersichtlich. In allen Gruppen wachsen wesentlich<br />
mehr Arten im basischen als im stark sauren Bereich.<br />
Setzt man den Anteil gefährdeter Arten in bezug auf Gesamtzahl<br />
aller Arten einer Zeigerwertklasse, wird als Tendenz<br />
sichtbar, daß mit niedrigeren Stickstoff-Werten und<br />
größeren Reaktionswerten das Gefährdungsmaß der Arten<br />
steigt. Arten mittlerer und reicher Standorte sind kaum gefährdet.<br />
Das bedeutet, daß der Druck auf die Vielzahl an Ar·<br />
ten, die durch Düngung und Bewirtschaftungsänderung be·<br />
reits allgemein gefährdet sind, durch Luftverunreinigungen<br />
noch verstärkt wird. Ausschlaggebend sind die Verbesserungen<br />
des Nährstoffangebotes armer Standorte durch die<br />
Deposition von Stickstoff oder anderen pflanzenverfügba·<br />
ren Nährstoffen und die Absenkung des ph-Wertes auf ungepuff~rten<br />
Böden. In beiden Fällen ergeben sich tiefgreifende<br />
Anderungen der Vegetation, die auf eine Verarmung<br />
der Flora bzw. Nivellierung der Vegetation herauslaufen. Ärmere<br />
Ausbildungen von Pflanzengesellschaften gleichen<br />
sich mittleren bis reichen an .<br />
2.12 Veränderungen der Lebensform<br />
Ein Ausrotten der Holländischen Ulmenkrankheit ist unmöglich.<br />
Solange anfällige Ulmen bestände verbleiben wird<br />
sich die Krankheit weiterhin ausbreiten. Andererseits i~t ein<br />
völliges Aussterben der Ulmen nicht zu befürchten. Einige<br />
erkrankte Bäume erholen sich nach einigen Jahren und trei·<br />
ben erneut aus. Allerdings wird der Hauptteil&der Ulmen in<br />
strauchiger Form als Unterwuchs und nicht wie bisher in der<br />
Baumschicht überleben. Das Ziel muß eine Kontrolle der<br />
Holländischen Ulmenkrankheit sein, in erster Linie ein Ein·<br />
schränken der Verluste, um die alten baumförmigen Ulmen<br />
so lange wie möglich erhalten zu können und sie nach und<br />
nach durch resistente Arten oder Neuzüchtungen zu ersetzen<br />
(SACHSE 1983).<br />
599