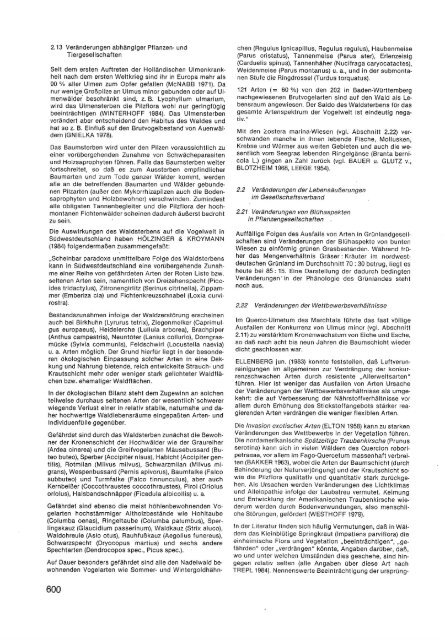Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.13 Veränderungen abhängiger Pflanzen- und<br />
Ti ergesellschaften<br />
Seit dem ersten Auftreten der Holländischen Ulmenkrankheit<br />
nach dem ersten Weltkrieg sind ihr in Europa mehr als<br />
90 % aller Ulmen zum Opfer gefallen (McNABB 1971). Da<br />
nur wenige. Großpilze an Ulmus minor gebunden oder auf Ulmenwälder<br />
beschränkt sind, z. B. Lyophyllum ulmarium,<br />
wird das Ulmensterben die Pilzflora wohl nur geringfügig<br />
beeinträchtigen (WINTERHOFF 1984). Das Ulmensterben<br />
verändert aber entscheidend den Habitus des Waldes und<br />
hat so z. B. Einfluß auf den Brutvogelbestand von Auenwäldern<br />
(GNIELKA 1978).<br />
Das Baumsterben wird unter den Pilzen voraussichtlich zu<br />
einer vorübergehenden Zunahme von Schwächeparasiten<br />
und Holzsaprophyten führen. Falls das Baumsterben weiter<br />
fortschreitet, so daß es zum Aussterben empfindlicher<br />
Baumarten und zum Tode ganzer Wälder kommt, werden<br />
alle an die betreffenden Baumarten und Wälder gebundenen<br />
Pilzarten (außer den Mykorrhizapilzen auch die Bodensaprophyten<br />
und Holzbewohner) verschwinden. Zumindest<br />
alle obligaten Tannenbegleiter und die Pilzflora der hochmontanen<br />
Fichtenwälder scheinen dadurch äußerst bedroht<br />
zu sein.<br />
Die Auswirkungen des Waldsterbens auf die Vogelwelt in<br />
Südwestdeutschland haben HÖLZINGER & KROYMANN<br />
(1984) folgendermaßen zusammengefaßt:<br />
„Scheinbar paradoxe unmittelbare Folge des Waldsterbens<br />
kann In Südwestdeutschland eine vorübergehende Zunahme<br />
einer Reihe von gefährdeten Arten der Roten Liste bzw.<br />
seltenen Arten sein, namentlich von Dreizehenspecht (Plcoides<br />
tridactylus), Zitronengirlitz (Serinus citrinella), Zippammer<br />
(Emberiza cia) und Fichtenkreuzschnabel (Loxla curvirostra).<br />
Bestandszunahmen infolge der Waldzerstörung erscheinen<br />
auch bei Birkhuhn (Lyrurus tetrix), Ziegenmelker (Caprimulgus<br />
europaeus), Heidelerche (Lullula arborea), Brachpiper<br />
(Anthus campestris), Neuntöter (Lanius collurio), Dorngrasmücke<br />
(Sylvia communis), Feldschwirl (Locustella naevia)<br />
u. a. Arten möglich. Der Grund hierfür liegt in der besonderen<br />
ökologischen Einpassung solcher Arten in eine Dekkung<br />
und Nahrung bietende, reich entwickelte Strauch- und<br />
Krautschicht mehr oder weniger stark gelichteter Waldflächen<br />
bzw. ehemaliger Waldflächen.<br />
In der ökologischen Bilanz steht dem Zugewinn an solchen<br />
teilweise durchaus seltenen Arten der wesentlich·schwerer<br />
wiegende Verlust einer in relativ stabile, naturnahe und da·<br />
her hochwertige Waldlebensräume eingepaßten Arten- und<br />
lndividuenfülle gegenüber.<br />
Gefährdet sind durch das Waldsterben zunächst die Bewohner<br />
der Kronenschicht der Hochwälder wie der Graurelher<br />
(Ardea cinerea) und die Greifvogelarten Mäusebussard (Buteo<br />
buteo), Sperber (Accipiter nisus), Habicht (Accipiter gentilis),<br />
Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmi lan (Mllvus migrans),<br />
Wespenbussard (Pern is apivorus), Baumfalke (Falco<br />
subbuteo) und Turmfalke (Falco tinnunculus), aber auch<br />
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes), Pirol (Oriolus<br />
oriolus), Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) u. a.<br />
Gefährdet sind ebenso die meist höhlenbewohnenden Vogelarten<br />
hochstämmiger Altholzbestände wie Hohltaube<br />
(Columba oenas), Ringeltaube (Columba palumbus), Sper·<br />
lingskauz (G laucidium passerinum), Waldkauz (Strlx aluco),<br />
Waldohreule (Asio otus), Rauhfußkauz (Aegolius funereus),<br />
Schwarzspecht (Dryocopus martius) und sechs andere<br />
Spechtarten (Dendrocopos spec., Picus spec.).<br />
Auf Dauer besonders gefährdet sind alle den Nadelwald bewohnenden<br />
Vogelarten wie Sommer· und Wintergoldhähn-<br />
chen (Regulus ignicapillus, Regulus regu lus), Haubenmeise<br />
(Parus cristatus), Tannen meise (Parus ater), Erlenzeisig<br />
(Carduelis spinus), Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes),<br />
Weidenmeise (Parus montanus) u. a., und in der submontanen<br />
Stufe die Ringdrossel (Turdus torquatus).<br />
121 Arten (== 60 %) von den 202 in Baden-Württemberg<br />
nachgewiesenen Brutvogelarten sind auf den Wald als Lebensraum<br />
angewiesen. Der Saldo des Waldsterbens für das<br />
gesamte Artenspektrum der Vogelwelt Ist eindeutig negativ."<br />
Mit den L.ostera marina-Wiesen (vgl. Abschnitt 2.22) verschwanden<br />
manche in ihnen lebende Fische, Mollusken,<br />
Krebse und Würmer aus weiten Gebieten und auch die wesentlich<br />
vom Seegras lebenden Ringelgänse (Branta bernicola<br />
L.) gingen an Zahl zurück (vgl. BAUER u. GLUTZ v.,<br />
BLOTZHEIM 1968, LEEGE 1954).<br />
2.2 Veränderungen der Lebensäußerungen<br />
im Gesellschaftsverband<br />
2.21 Veränderungen von B/Ohaspekten<br />
in Pflanzengesellschaften<br />
Auffällige Folgen des Ausfalls von Arten in Grünlandgesellschaften<br />
sind Veränderungen der Blühaspekte von bunten<br />
Wiesen zu einförmig grünen Grasbeständen. Während früher<br />
das Mengenverhältnis Gräser: Kräuter im nordwestdeutschen<br />
Grünland im Durchschnitt 70: 30 betrug, liegt es<br />
heute bei 85: 15. Eine Darstellung der dadurch bedingten<br />
Veränderungen· in der Phänologie des Grünlandes steht<br />
noch aus.<br />
2.22 Veränderungen der Wettbewerbsverhältnisse<br />
Im Querco-Ulmetum des Marchtals führte das fast völlige<br />
Ausfallen der Konkurrenz von Ulmus minor (vg l. Abschnitt<br />
2.11) zu verstärktem Kronenwachstum von Eiche und Esche<br />
so daß nach acht bis neun Jahren die Baumschicht wiede;<br />
dicht geschlossen war.<br />
ELLENBERG jun. (1983) konnte feststellen, daß Luftverunreinigungen<br />
im allgemeinen zur Verdrängung der konkurrenzschwachen<br />
Arten durch resistente „Allerweltsarten"<br />
führen. Hier ist weniger das Ausfallen von Arten Ursache<br />
der Veränderungen der Wettbewerbsverhältnisse als umgekehrt:<br />
die auf Verbesseru ng der Nährstoffverh ältnisse vor<br />
al lem durch Erhöhung des Stickstoffangebots stärker reagierenden<br />
Arten verdrängen die weniger flexiblen Arten.<br />
Die Invasion exotischer Arten (ELTON 1958) kann zu starken<br />
Veränderungen des Wettbewerbs in der Vegetation führen.<br />
Die nordamerikan ische Spätzeitige Traubenkirsche (Prunus<br />
serotina) kann sich in vielen Wäldern des Quercion roboripetraeae,<br />
vo r allem im Fago-Quercetum massenhaft verbreiten<br />
(BAKKER 1963), wobei die Arten der Baumschicht (durch<br />
Behinderung der Naturverjüngung) und der Krautschicht sowie<br />
die Pilzflora qualitativ und quantitativ stark zurückgehen.<br />
Als Ursachen werden Veränderungen des Lichtklimas<br />
und Allelopathie infolge der Laubstreu vermutet. Keimung<br />
und Entwicklung der Amerikanischen Traubenkirsche wiederum<br />
werden durch Bodenverwundungen, also menschliche<br />
Störungen, gefördert (WESTHOFF 1979).<br />
In der Literatur finden sich häufig Vermutungen, daß in Wäldern<br />
das Kl einblütige Springkraut (lmpatiens parviflora) die<br />
einheimische Flora und Veg etation „ beeinträcht igen", „gefährden<br />
" oder „verdrängen" könnte, Angaben darüber, daß,<br />
wo und unter welchen Umständen dies geschehe, sind hingegen<br />
relativ selten (alle Angaben über diese Art nach<br />
TREPL 1984). Nennenswerte Beeinträchtigung der ursprüng-<br />
600