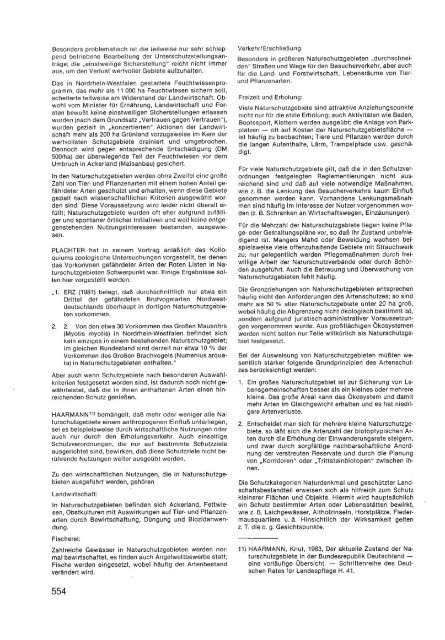Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Besonders problematisch ist die teilweise nur sehr schleppend<br />
betriebene Bearbeitung der Unterschutzstellungsanträge;<br />
die „einstweilige Sicherstellung" reicht nicht immer<br />
aus, um den Verlust wertvoller Gebiete aufzuhalten.<br />
Das in Nordrhein-Westfalen gestartete Feuchtwiesenprogramm,<br />
das mehr als 11 000 ha Feuchtwiesen sichern soll,<br />
scheiterte teilweise am Widerstand der Landwirtschaft. Obwohl<br />
vom Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
bewußt keine einst weiligen Sicherstellungen erlassen<br />
wurden (nach dem Grundsatz „Vertrauen gegen Vertrauen"),<br />
wurden gezielt in „ konzertierten" Aktionen der Landwirtschaft<br />
mehr als 200 ha Grünland vorzugsweise im Kern der<br />
wertvollsten Schutzgebiete drainier·t und umgebrochen.<br />
Dennoch wird gegen entsprechende Entschädigung (DM<br />
500/ha) der überwiegende Teil der Feuchtwiesen vor dem<br />
Umbruch in Ackerland (Maisanbau) gesichert.<br />
In den Naturschutzgebieten werden ohne Zweifel eine große<br />
Zahl von Tier- und Pflanzenarten mit einem hohen Anteil gefährdeter<br />
Arten geschützt und erhalten, wenn diese Gebiete<br />
gezielt nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt worden<br />
sind. Diese Voraussetzung wird leider nicht überall erfüllt;<br />
Naturschutzgebiete wurden oft eher aufgrund zufälliger<br />
und spontaner örtlicher In itiativen und weil keine entgegenstehenden<br />
Nutzungsinteressen bestanden, ausgewiesen.<br />
PLACHTER hat in seinem Vortrag anläßlich des Kolloquiums<br />
zoologische Untersuchungen vorgestellt, bei denen<br />
das Vorkommen gefährdeter Arten der Roten Listen in Naturschutzgebieten<br />
Schwerpunkt war. Einige Ergebnisse sollen<br />
hier vorgestellt werden:<br />
„ 1. ERZ (1981) belegt, daß durchschnittlich nur etwa ein<br />
Drittel der gefährdeten Brutvogelarten Nordwestdeutschlands<br />
überhaupt in dortigen Naturschutzgebieten<br />
vorkommen.<br />
2. 2. Von den etwa 30 Vorkommen des Großen Mausohrs<br />
(Myotis myotis) in Nordrhein-Westfalen befindet sich<br />
kein ei nziges in einem bestehenden Naturschutzgebiet;<br />
im gleichen Bundesland sind derzeit nur etwa 10 % der<br />
Vorkommen des Großen Brachvogels (Numenius arquata)<br />
in Naturschutzgebieten enthalten_"<br />
Aber auch wenn Sch utzgebiete nach besonderen Auswahlkriterien<br />
festgesetzt worden sind, ist dadurch noch nicht gewäh<br />
rleistet, daß die in ihnen enthaltenen Arten einen hinreichenden<br />
Schutz genießen.<br />
HAARMANN11) bemängelt, daß mehr oder weniger alle Naturschutzgebiete<br />
einem anthropogenen Einfluß unterliegen,<br />
sei es beispielsweise durch wirtschaftliche Nutzungen oder<br />
auch nur durch den Erholungsverkehr. Auch einseitige<br />
Schutzverordnungen, die nur auf bestimmte Schutzziele<br />
ausgerichtet sind, bewirken, daß diese Schutzziele nicht berührende<br />
Nutzungen weiter ausgeübt werden.<br />
Zu den wirtschaftlichen Nutzungen, die in Naturschutzgebieten<br />
ausgeführt werden, gehören<br />
Landwirtschaft:<br />
In Naturschutzgebieten befinden sich Ackerland, Fettwiesen,<br />
Obstkulturen mit Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten<br />
durch Bewirtschaftung, Düngung und Biozidanwendung.<br />
Fischerei:<br />
Zahlreiche Gewässer in Naturschutzgebieten werden normal<br />
bewirtschaftet, es finden auch Angelwettbewerbe statt;<br />
Fische werden eingesetzt, wobei häufig der Artenbestand<br />
verändert wird.<br />
Verkehr/Erschließung:<br />
Besonders in größeren Naturschutzgebieten „durchschneiden"<br />
Straßen und Wege für den Besucherverkehr, aber auch<br />
für die Land- und Forstw irtschaft, Lebensräume von Tierund<br />
Pflanzenarten.<br />
Freizeit und Erholung:<br />
Viele Naturschutzgebiete sind attraktive Anziehungspunkte<br />
nicht nur für die stille Erholung; auch Aktivitäten wie Baden,<br />
Bootssport, Klettern werden ausgeübt; die Anlage von Parkplätzen<br />
- oft auf Kosten der Naturschutzgebietsfläche -<br />
ist häufig zu beobachten; Tiere und Pflanzen werden durch<br />
die langen Aufenthalte, Lärm, Trampelpfade usw. geschädigt.<br />
Für viele Naturschutzgebiete gilt, daß die in den Schutzverordnungen<br />
festgelegten Reglementierungen nicht ausreichend<br />
sind und daß auf viele notwendige Maßnahmen,<br />
wie z. B. die Lenkung des Besucherverkehrs kaum Einfluß<br />
genommen werden kann. vorhandene Lenkungsmaßnahmen<br />
sind häufig im Interesse der Nutzer vorgenommen worden<br />
(z. B. Schranken an Wirtschaftswegen, Einzäunungen).<br />
Für die Mehrzahl der Naturschutzgebiete liegen keine Pflege-<br />
oder Gestaltungspläne vor, so daß ihr Zustand unbefriedigend<br />
ist. Mangels Mahd oder Beweidung wachsen beispielsweise<br />
viele offenzuhaltende Gebiete mit Strauchwerk<br />
zu; nur gelegentlich werden Pflegemaßnahmen durch freiwill<br />
ige Arbeit der Naturschutzverbände oder durch Behörden<br />
ausgeführt. Auch die Betreuung und Überwachung von<br />
Naturschutzgebieten fehlt häufig.<br />
Die Grenzziehungen von Naturschutzgebieten entsprechen<br />
häufig nicht den Anforderungen des <strong>Artenschutz</strong>es; so sind<br />
mehr als 50 % aller Naturschutzgebiete unter 20 ha groß,<br />
wobei häufig die Abgrenzung nicht ökologisch bestimmt ist,<br />
sondern aufgrund juristisch-administrativer Voraussetzungen<br />
vorgenommen wurde. Aus großflächigen Ökosystemen<br />
werden nicht selten nur Teile willkürlich als Naturschutzgebiet<br />
festgesetzt.<br />
Bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten müßten wesentlich<br />
stärker folgende Grundprinzipien des <strong>Artenschutz</strong>es<br />
berücksichtigt werden:<br />
1. Ein großes Naturschutzgebiet ist zur Sicherung von Lebensgemeinschaften<br />
besser als ein kleines oder mehrere<br />
k leine. Das große Areal kann das Ökosystem und damit<br />
mehr Arten im Gleichgewicht erhalten und es hat niedrigere<br />
Artenverluste.<br />
2. Entscheidet man sich für mehrere kleine Naturschutzgebiete,<br />
so läßt sich die Artenzahl der biotoptypischen Arten<br />
durch die Erhöhung der Einwanderungsrate steigern,<br />
und zwar durch sorgfältige nachbarschaftliche Anordnung<br />
der verstreuten Reservate und durch die Planung<br />
von „ Korridoren" oder „Trittsteinbiotopen" zwischen ihnen.<br />
Die Schutzkategorien Naturdenkmal und geschützter Landschaftsbestandtei<br />
l erweisen sich als hilfreich zum Schutz<br />
kleinerer Flächen und Objekte. Hiermit wird hauptsächlich<br />
ein Schutz bestimmter Arten oder Lebensstätten bewirkt,<br />
wie z. B. Laichgewässer, Altholzinseln, Horstplätze, Fledermausquartiere<br />
u. ä. Hinsichtlich der Wirksamkeit gelten<br />
z. T. die o. g. Gesichtspunkte.<br />
11) HAARMANN, Knut, 1983, Der aktuelle Zustand der Naturschutzgebiete<br />
in der Bundesrepublik Deutschland -<br />
eine vorläufige Übersicht. - Schriftenreihe des Deutschen<br />
<strong>Rat</strong>es für <strong>Landespflege</strong> H. 41 .<br />
554