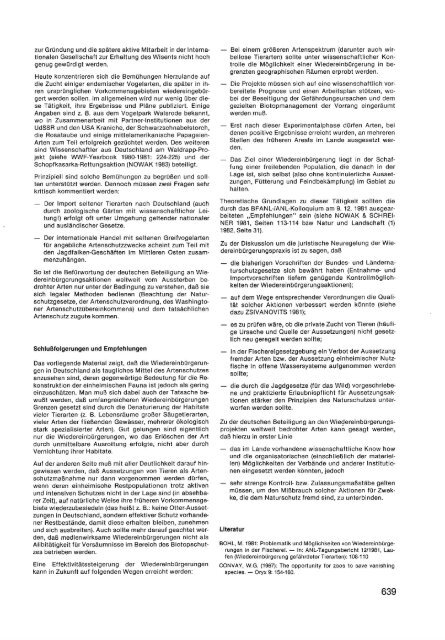Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zur Gründung und die spätere aktive Mitarbeit in der Internationalen<br />
Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents nicht hoch<br />
genug gewürdigt werden.<br />
Heute konzentrieren sich die Bemühungen hierzulande auf<br />
die Zucht einiger endemischer Vogelarten, die später in ihren<br />
ursprünglichen Vorkommensgebieten wiedereingebürgert<br />
werden sollen. Im allgemeinen wird nur wenig über diese<br />
Tätigkeit, ihre Ergebnisse und Pläne publiziert. Einige<br />
Angaben sind z. B. aus dem Vogelpark Walsrode bekannt,<br />
wo in Zusammenarbeit mit Partner-Institutionen aus der<br />
UdSSR und den USA Kraniche, der Schwarzschnabelstorch,<br />
die Rosataube und einige mittelamerikanische Papageien<br />
Arten zum Teil erfolgreich gezüchtet werden. Des weiteren<br />
sind Wissenschaftler aus Deutschland am Waldrapp-Projekt<br />
(siehe WWF-Yearbook 1980-1981 : 224-225) und der<br />
Schopfkasarka-Rettungsaktion (NOWAK 1983) beteiligt.<br />
Prinzipiell sind solche Bemühungen zu begrüßen und sollten<br />
unterstützt werden. Dennoch müssen zwei Fragen sehr<br />
kritisch kommentiert werden:<br />
- Der Import seltener Tierarten nach Deutschland (auch<br />
durch zoologische Gärten mit wissenschaftlicher Leitung!)<br />
erfolgt oft unter Umgehung geltender nationaler<br />
und ausländischer Gesetze.<br />
Der internationale Handel mit seltenen Greifvogelarten<br />
für angebliche <strong>Artenschutz</strong>zwecke scheint zum Teil mit<br />
den Jagdfalken-Geschäften im Mittleren Osten zusammenzuhängen.<br />
So ist die Befürwortung der deutschen Beteiligung an Wiedereinbürgerungsaktionen<br />
weltweit vom Aussterben bedrohter<br />
Arten nur unter der Bedingung zu verstehen, daß sie<br />
sich legaler Methoden bedienen (Beachtung der Naturschutzgesetze,<br />
der <strong>Artenschutz</strong>verordnung, des Washingtoner<br />
<strong>Artenschutz</strong>übereinkommens) und dem tatsächlichen<br />
<strong>Artenschutz</strong> zugute kommen.<br />
Schlußfolgerungen und Empfehlungen<br />
Das vorliegende Material zeigt, daß die Wiedereinbürgerungen<br />
in Deutschland als taugliches Mittel des <strong>Artenschutz</strong>es<br />
anzusehen sind, deren gegenwärtige Bedeutung für die Rekonstruktion<br />
der einheimischen Fauna ist jedoch als gering<br />
einzuschätzen. Man muß sich dabei auch der Tatsache bewußt<br />
werden, daß umfangreicheren Wiedereinbürgerungen<br />
Grenzen gesetzt sind durch die Denaturierung der Habitate<br />
vieler Tierarten (z. B. Lebensräume großer Säugetierarten,<br />
vieler Arten der fließenden Gewässer, mehrerer ökologisch<br />
stark spezialisierter Arten). Gut gelungen sind eigentlich<br />
nur die Wiedereinbürgerungen, wo das Erlöschen der Art<br />
durch unmittelbare Ausrottung erfolgte, nicht aber durch<br />
Vernichtung ihrer Habitate.<br />
Auf der anderen Seite muß mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen<br />
werden, daß Aussetzungen von Tieren als <strong>Artenschutz</strong>maßnahme<br />
nur dann vorgenommen werden dürfen,<br />
wenn deren einheimische Restpopulationen trotz aktiven<br />
und intensiven Schutzes nicht in der Lage sind (in absehbarer<br />
Zeit), auf natürliche Weise ihre früheren Vorkommensgebiete<br />
wiederzubesiedeln (das heißt z. B.: keine Otter-Aussetzungen<br />
in Deutschland, sondern effektiver Schutz vorhandener<br />
Restbestände, damit diese erhalten bleiben, zunehmen<br />
und sich ausbreiten). Auch sollte mehr darauf geachtet werden,<br />
daß medienwirksame Wiedereinbürgerungen nicht als<br />
Alibitätigkeit für Versäumnisse im Bereich des Biotopschutzes<br />
betrieben werden.<br />
Eine Effektivitätssteigerung der Wiedereinbürgerungen<br />
kann in Zukunft auf folgenden Wegen erreicht werden:<br />
- Bei einem größeren Artenspektrum (darunter auch wirbellose<br />
Tierarten) sollte unter wissenschaftlicher Kontrolle<br />
die Möglichkeit einer Wiedereinbürgerung in begrenzten<br />
geographischen Räumen erprobt werden.<br />
- Die Projekte müssen sich auf eine wissenschaftlich vorbereitete<br />
Prognose und einen Arbeitsplan stützen, wobei<br />
der Beseitigung der Gefährdungsursachen und dem<br />
gezielten Biotopmanagement der Vorrang eingeräumt<br />
werden muß.<br />
- Erst nach dieser Experimentalphase dürfen Arten, bei<br />
denen positive Ergebnisse erreicht wurden, an mehreren<br />
Stellen des früheren Areals im lande ausgesetzt werden.<br />
Das Ziel einer Wiedereinbürgerung liegt in der Schaffung<br />
einer freilebenden Population, die danach in der<br />
Lage ist, sich selbst (also ohne kontinuierliche Aussetzungen,<br />
Fütterung und Feindbekämpfung) im Gebiet zu<br />
halten.<br />
Theoretische Grundlagen zu dieser Tätigkeit sollten die<br />
durch das BFANL-/ANL-Kolloquium am 9. 12. 1981 ausgearbeiteten<br />
„Empfehlungen" sein (siehe NOWAK & SCHREI<br />
NER 1981, Seiten 113-114 bzw Natur und Landschaft (1)<br />
1982, Seite 31).<br />
Zu der Diskussion um die juristische Neuregelung der Wie·<br />
dereinbürgerungspraxis ist zu sagen, daß<br />
- die bisherigen Vorschriften der Bundes- und Ländernaturschutzgesetze<br />
sich bewährt haben (Entnahme- und<br />
Importvorschriften liefern genügende Kontrollmöglichkeiten<br />
der Wiedereinbürgerungsaktionen);<br />
auf dem Wege entsprechender Verordnungen die Qualität<br />
solcher Aktionen verbessert werden könnte (siehe<br />
dazu ZSIVANOVITS 1981);<br />
- es zu prüfen wäre, ob die private Zucht von Tieren (häufi·<br />
ge Ursache und Quelle der Aussetzungen) nicht gesetz·<br />
lieh neu geregelt werden sollte;<br />
- in der Fischereigesetzgebung ein Verbot der Aussetzung<br />
fremder Arten bzw. der Aussetzung einheimischer Nutzfische<br />
in offene Wassersysteme aufgenommen werden<br />
sollte;<br />
die durch die Jagdgesetze (für das Wild) vorgeschriebe·<br />
ne und praktizierte Erlaubnispflicht für Aussetzungsak·<br />
tionen stärker den Prinzipien des Naturschutzes unterworfen<br />
werden sollte.<br />
Zu der deutschen Beteiligung an den Wiedereinbürgerungsprojekten<br />
weltweit bedrohter Arten kann gesagt werden,<br />
daß hierzu in erster Linie<br />
das im lande vorhandene wissenschaftliche Know how<br />
und die organisatorischen (einschließlich der material·<br />
len) Möglichkeiten der Verbände und anderer Institutionen<br />
eingesetzt werden könnten, jedoch<br />
sehr strenge Kontroll· bzw. Zulassungsmaßstäbe gelten<br />
müssen, um den Mißbrauch solcher Aktionen für Zwek·<br />
ke, die dem Naturschutz fremd sind, zu unterbinden.<br />
Literatur<br />
SOHL, M. 1981: Problematik und Möglichkeiten von Wiedereinbürgerungen<br />
in der Fischerei. - In: ANL-Tagungsbericht 12/1981, Laufen<br />
(Wiedereinbürgerung gefährdeter Tierarten): 108-110<br />
CONVAY, W.G. (1 967): The opportunity for zoos to save vanishing<br />
species. - Oryx 9: 154-160.<br />
639