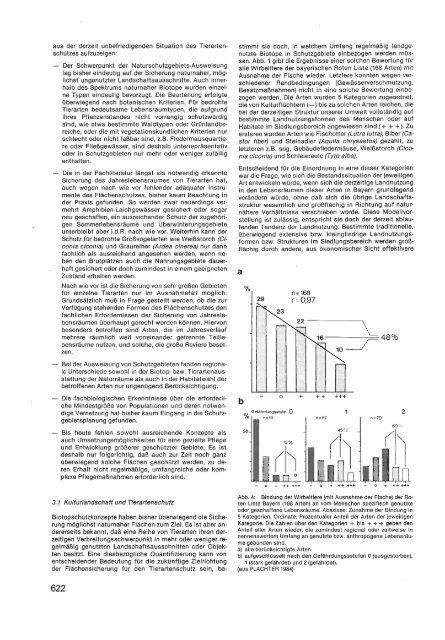Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
aus der derzeit unbefriedigenden Situation des Tierartenschutzes<br />
aufzuzeigen:<br />
Der Schwerpunkt der Naturschutzgebiets-Ausweisung<br />
lag bisher eindeutig auf der Sicherung naturnaher, möglichst<br />
ungenutzter Landschaftsausschnitte. Auch innerhalb<br />
des Spektrums naturnaher Biotope wurden einzelne<br />
Typen eindeutig bevorzugt. Die Beurteilung erfolgte<br />
überwiegend nach botanischen Kriterien. Für bedrohte<br />
Tierarten bedeutsame Lebensraumtypen, die aufgrund<br />
ihres Pflanzenstandes nicht vorrangig schutzwürdig<br />
sind, wie etwa bestimmte Waldtypen oder Grünlandbereiche,<br />
oder die mit vegetationskundlichen Kriterien nur<br />
schlecht oder nicht faßbar sind, z.B. Fledermausquartiere<br />
oder Fließgewässer, sind deshalb unterrepräsentativ<br />
oder in Schutzgebieten nur mehr oder weniger zufällig<br />
enthalten.<br />
- Die in der Fachliteratur längst als notwendig erkannte<br />
Sicherung des Jahreslebensraumes von Tierarten hat,<br />
auch wegen nach wie vor fehlender adäquater Instrumente<br />
des Flächenschutzes, bisher kaum Beachtung in<br />
der Praxis gefunden. So werden zwar neuerdings vermehrt<br />
Amphibien-Laichgewässer gesichert oder sogar<br />
neu geschaffen, ein ausreichender Schutz der zugehörigen<br />
Sommerlebensräume und Überwinterungsgebiete<br />
unterbleibt aber i.d.R. nach wie vor. Weiterhin kann der<br />
Schutz für bedrohte Großvogelarten wie Weißstorch (Ciconia<br />
ciconia) und Graureiher (Ardea cinerea) nur dann<br />
fachlich als ausreichend angesehen werden, wenn neben<br />
den Brutplätzen auch die Nahrungsgebiete dauerhaft<br />
gesichert oder doch zumindest in einem geeigneten<br />
Zustand erhalten werden.<br />
Nach wie vor ist die Sicherung von sehr großen Gebieten<br />
für einzelne Tierarten nur im Ausnahmefall möglich.<br />
Grundsätzlich muß in Frage gestellt werden, ob die zur<br />
Verfügung stehenden Formen des Flächenschutzes den<br />
fachlichen Erfordernissen der Sicherung von Jahreslebensräumen<br />
überhaupt gerecht werden können. Hiervon<br />
besonders betroffen sind Arten, die im Jahresverlauf<br />
mehrere räumlich weit voneinander getrennte Teillebensräume<br />
nutzen, und solche, die große Reviere besetzen.<br />
stimmt sie doch, in welchem Umfang regelmäßig landgenutzte<br />
Biotope in Schutzgebiete einbezogen werden müssen.<br />
Abb. 1 gibt die Ergebnisse einer solchen Bewertung für<br />
alle Wirbeltiere der bayerischen Roten Liste (168 Arten) mit<br />
Ausnahme der Fische wieder. Letztere konnten wegen verschiedener<br />
Randbedingungen (Gewässerverschmutzung,<br />
Besatzmaßnahmen) nicht in eine solche Bewertung einbezogen<br />
werden. Die Arten wurden 5 Kategorien zugeordnet,<br />
die von Kulturflüchtern(-) bis zu solchen Arten reichen, die<br />
bei der derzeitigen Struktur unserer Umwelt vollständig auf<br />
bestimmte Landnutzungsformen des Menschen oder auf<br />
Habitate im Siedlungsbereich angewiesen sind ( + + +). Zu<br />
ersteren wurden Arten wie Fischotter (Lutra lutra), Biber (Gastor<br />
fiber) und Steinadler (Aquila chrysaetos) gezählt, zu<br />
letzteren z.B. sog. Gebäudefledermäuse, Weißstorch (Ciconia<br />
ciconia) und Schleiereule (Tyto alba).<br />
Entscheidend für die Einordnung in eine dieser Kategorien<br />
war die Frage, wie sich die Bestandssituation der jeweiligen<br />
Art entwickeln würde, wenn sich die derzeitige Landnutzung<br />
in den Lebensräumen dieser Arten in Bayern grundlegend<br />
verändern würde, ohne daß sich die übrige Landschaftsstruktur<br />
wesentlich und großflächig in Richtung auf naturnähere<br />
Verhältnisse verschieben würde. Diese Modellvorstellung<br />
ist zulässig, entspricht sie doch der derzeit ablaufenden<br />
Tendenz der Landnutzung: Bestimmte traditionelle,<br />
überwiegend extensive bzw. kleingliedrige Landnutzungsformen<br />
bzw. Strukturen im Siedlungsbereich werden großflächig<br />
durch andere, aus ökonomischer Sicht effektivere<br />
a<br />
%<br />
29<br />
n =168<br />
r = 0,97<br />
22 ------~<br />
10<br />
_/48%<br />
- Bei der Ausweisung von Schutzgebieten fanden regionale<br />
Unterschiede sowohl in der Biotop- bzw. Tierartenausstattung<br />
der Naturräume als auch in der Habitatwahl der<br />
betroffenen Arten nur ungenügend Berücksichtigung.<br />
0<br />
- Die fachbiologischen Erkenntnisse über die erforderliche<br />
Mindestgröße von Populationen und deren notwendige<br />
Vernetzung hat bisher kaum Eingang in die Schutzgebietsplanung<br />
gefunden.<br />
b<br />
Gefährdungsstufe 0<br />
% n:16<br />
0<br />
+<br />
++ +++<br />
n=82 n=70<br />
2<br />
- Bis heute fehlen sowohl ausreichende Konzepte als<br />
auch Umsetzungsmöglichkeiten für eine gezielte Pflege<br />
und Entwicklung größerer geschützter Gebiete. Es ist<br />
deshalb nur folgerichtig, daß auch zur Zeit noch ganz<br />
überwiegend solche Flächen geschützt werden, zu deren<br />
Erhalt nicht regelmäßige, umfangreiche oder komplexe<br />
Pflegemaßnahmen erforderlich sind.<br />
50<br />
- 0 + ++ +++<br />
0 + ++ +++ 0 + + + +++<br />
3. 1 Kulturlandschaft und Tierartenschutz<br />
Biotopschutzkonzepte haben bisher überwiegend die Sicherung<br />
möglichst naturnaher Flächen zum Ziel. Es ist aber andererseits<br />
bekannt, daß eine Reihe von Tierarten ihren derzeitigen<br />
Verbreitungsschwerpunkt in mehr oder weniger regelmäßig<br />
genutzten Landschaftsausschnitten oder Objekten<br />
besitzt. Eine diesbezügliche Quantifizierung kann von<br />
entscheidender Bedeutung für die zukünftige Zielrichtung<br />
der Flächensic herun g für den Tierartenschutz sein, be-<br />
Abb. 4: Bindung der Wirbeltiere (mit Ausnahme der Fische) der Roten<br />
Liste Bayern (168 Arten) an vom Menschen spezifisch genutzte<br />
oder geschaffene Lebensräume. Abszisse: Zunahme der Bindung in<br />
5 Kategorien; Ordinate: Prozentualer Anteil der Arten der jeweiligen<br />
Kategorie. Die Zahlen Ober den Kategorien + bis + + + geben den<br />
Anteil· aller Arten wieder, die zumindest regional oder zeitweise In<br />
nennenswertem Umfang an genutzte bzw. anthropogene Lebensräume<br />
gebunden sind.<br />
a) alle berücksichtigte Arten<br />
b) aufgeschlüsselt nach den Gefährdungssstufen 0 (ausgestorben),<br />
1 (stark gefährdet) und 2 (gefährdet).<br />
(aus PLACHTER 1984)<br />
622