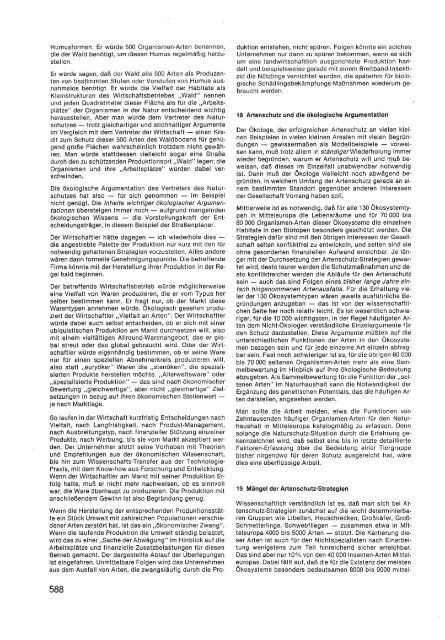Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Humusformen. Er würde 500 Organismen-Arten benennen,<br />
die der Wald benötigt, um diesen Humus regelmäßig herzustellen.<br />
Er würde sagen, daß der Wald alle 500 Arten als Produzen·<br />
ten von bestimmten Stufen oder Vorstufen von Humus ausnahmslos<br />
benötigt. Er würde die Vielfalt der Habitate als<br />
Kleinstrukturen des Wirtschaftsbetriebes „ Wald" nennen<br />
und jeden Quadratmeter dieser Fläche als für die „Arbeitsplätze"<br />
der Organismen in der Natur entscheidend wichtig<br />
herausstellen. Aber man würde dem Vertreter des Naturschutzes<br />
- trotz gleichartiger und stichhaltiger Argumente<br />
im Vergleich mit dem Vertreter der Wirtschaft - einen Kre·<br />
dit zum Schutz dieser 500 Arten des Waldbodens für genügend<br />
große Flächen wahrscheinlich trotzdem nicht gewähren<br />
. Man würde stattdessen vielleicht sogar eine Straße<br />
durch den zu schützenden Produktionsort „Wald" legen; die<br />
Organismen und ihre „Arbeitsplätze" würden dabei verschwinden.<br />
Die ökologische Argumentation des Vertreters des Naturschutzes<br />
hat also - für sich genommen - im Beispiel<br />
nicht genügt. Die Inhalte wichtiger ökologischer Argumentationen<br />
übersteigen immer noch - aufgrund mangelnden<br />
ökologischen Wissens - die Vorstellungskraft der Entscheidungsträger,<br />
in diesem Beispiel der Straßenplaner.<br />
Der Wirtschaftler hätte dagegen - ich wiederhole dies -<br />
die angestrebte Palette der Produktion nur kurz mit den für<br />
notwendig gehaltenen Strategien vorzustellen. Alles andere<br />
wären dann formelle Genehmigungspunkte. Die betreffende<br />
Firma könnte mit der Herstellung ihrer Produktion in der Regel<br />
bald beginnen.<br />
Der bet reffende Wirtschaftsbetrieb würde möglicherweise<br />
eine Vielfalt von Waren produzieren, die er vom Typus her<br />
selber bestimmen kann. Er fragt nur, ob der Markt diese<br />
Warentypen annehmen würde. Ökologisch gesehen produziert<br />
der Wirtschaftler „ Vielfalt an Arten". Der Wirtschaftler<br />
wü rde dabei auch selbst entscheiden, ob er sich mit einer<br />
ubiquistischen Produktion am Markt durchsetzen will, also<br />
mit einem vielfältigen Allround-Warenangebot, das er global<br />
streut oder das global gebraucht wird. Oder der Wirtschaftler<br />
würde eigenhändig bestimmen, ob er seine Ware<br />
nur für einen speziellen Abnehmerkreis produzieren will,<br />
also statt „ euryöker" Waren die „ stenöken", die spezial i<br />
sierten Produkte herstellen möchte. „ Allerweltsware" oder<br />
„spezialisierte Produktion" - das sind nach ökonomischer<br />
Bewertung „gleichwertige", aber nicht „gleichartige" Zielsetzungen<br />
in bezug auf ihren ökonomischen Stellenwert -<br />
je nach Marktlage.<br />
So laufen in der Wirtschaft kurzfristig Entscheidungen nach<br />
Vielfalt, nach Langfristigkeit, nach Produkt-Management,<br />
nach Ausbreitungstyp, nach finanzieller Stützung einzelner<br />
Produkte, nach Werbung, bis sie vom Markt akzeptiert werden.<br />
Der Unternehmer stützt seine Vorhaben mit Theorien<br />
und Empfehlungen aus der ökonomischen Wissenschaft,<br />
bis hin zum Wissenschafts-Transfer aus der Technologie<br />
Praxis, mit dem Know-how aus Forschung und Entwicklung.<br />
Wenn der Wirtschaftler am Markt mit seiner Produktion Erfolg<br />
hatte, muß er nicht mehr nachweisen, ob es sinnvoll<br />
war, die Ware Oberhaupt zu produzieren. Die Produktion mit<br />
anschließendem Gewinn ist also Begründung genug.<br />
Wenn die Herstellung der entsprechenden Produktionsstätte<br />
ein Stück Umwelt mit zahlreichen Populationen verschie·<br />
dener Arten zerstört hat, ist das ein „ökonomischer Zwang".<br />
Wenn die laufende Produktion die Umwelt ständig belastet,<br />
wird das zu einer „Sache der Abwägung" im Hinblick auf die<br />
Arbeitsplätze und finanzielle Zusatzbelastungen für diesen<br />
Betrieb gemacht. Der dargestellte Ablauf der Überlegungen<br />
ist eingefahren. Unmittelbare Folgen wird das Unternehmen<br />
aus dem Ausfall von Arten, die zwangsläufig durch die Pro·<br />
duktion entstehen, nicht spüren. Folgen könnte ein solches<br />
Unternehmen nur dann zu spüren bekommen, wenn es sich<br />
um eine landwirtschaftlich ausgerichtete Produktion handelt<br />
und beispielsweise gerade mit einem Breitband-Insektizid<br />
die Nützlinge vernichtet wurden, die späterhin für biologische<br />
Schädlingsbekämpfungs-Maßnahmen wiederum gebraucht<br />
werden.<br />
18 <strong>Artenschutz</strong> und die ökologische Argumentation<br />
Der Ökologe, der erfolgreichen <strong>Artenschutz</strong> an vielen kleinen<br />
Beispielen in vielen kleinen Arealen mit vielen Begründungen<br />
- gewissermaßen als Modellbeispiele - vorweisen<br />
kann, muß trotz allem in ständiger Wiederholung immer<br />
wieder begründen, warum er <strong>Artenschutz</strong> will und muß beweisen,<br />
daß dieses im Einzelfall unabwendbar notwendig<br />
ist. Dann muß der Ökologe vielleicht noch abwägend begründen,<br />
in welchem Umfang der <strong>Artenschutz</strong> gerade an einem<br />
bestimmten Standort gegenüber anderen Interessen<br />
der Gesellschaft Vorrang haben soll.<br />
Mittlerweile ist es notwendig, daß für alle 130 Ökosystemtypen<br />
in Mitteleuropa die Lebensräume und für 70 000 bis<br />
80 000 Organismen-Arten dieser Ökosysteme die einzelnen<br />
Habitate in den Biotopen besonders geschützt werden. Die<br />
Strategien dafür sind mit aen übrigen Interessen der Gesellschaft<br />
selten konfliktfrei zu entwickeln, und selten sind sie<br />
ohne gesonderten finanziellen Aufwand erreichbar. Je länger<br />
mit der Durchsetzung der <strong>Artenschutz</strong>-Strategien gewartet<br />
wird, desto teurer werden die Schutzmaßnahmen und desto<br />
konfliktreicher werden die Abläufe für den <strong>Artenschutz</strong><br />
sein - auch das sind Folgen eines bisher lange Jahre einfach<br />
hingenommenen Artenausfalls. Für die Erhaltung vieler<br />
der 130 Ökosystemtypen wären jeweils ausführliche Begründungen<br />
anzugeben - das ist von der wissenschaftlichen<br />
Seite her noch.re lativ leicht. Es ist wesentlich schwieriger,<br />
für die 10 000 wichtigsten, in der Regel häufigsten Arten<br />
dem Nicht-Ökologen verständliche Einzelargumente für<br />
den Schutz darzustellen. Diese Argumente müßten auf die<br />
unterschiedlichen Funktionen der Arten in den Ökosystemen<br />
bezogen sein und für jede einzelne Art einzeln abfragbar<br />
sein. Fast noch schwieriger ist es, für die übrigen 60 000<br />
bis 70 000 seltenen Organismen-Arten mehr als eine Sammelbewertung<br />
im Hinblick auf ihre ökologische Bedeutung<br />
abzugeben. Als Sammelbewertung für die Funktion der „seltenen<br />
Arten" im Naturhaushalt kann die Notwendigkeit der<br />
Ergänzung des genetischen Potentials, das die häufigen Arten<br />
darstellen, angesehen werden.<br />
Man sollte die Arbeit meiden, etwa die Funktionen von<br />
Zehntausenden häufiger Organismen-Arten für den Naturhaushalt<br />
in Mitteleuropa katalogmäBig zu erfassen. Denn<br />
solange die Naturschutz-Situation durch die Erfahrung gekennzeichnet<br />
wird, daß selbst eine bis in letzte detaillierte<br />
Faktoren-Erfassung Ober die Bedeutung einer Tiergruppe<br />
bisher nirgendwo für deren Schutz ausgereicht hat, wäre<br />
dies eine überflüssige Arbeit.<br />
19 Mängel der <strong>Artenschutz</strong>-Strategien<br />
Wissenschaftlich verständlich ist es, daß man sich bei <strong>Artenschutz</strong>-Strategien<br />
zunächst auf die leicht determinierbaren<br />
Gruppen wie Libellen, Heuschrecken, Großkäfer, Groß<br />
Schmetterlinge, Schwebfliegen - zusammen etwa in Mitteleuropa<br />
4000 bis 5000 Arten - stützt. Die Kartierung dieser<br />
Arten ist auch für den Nichtspezialisten nach Einarbeitung<br />
wenigstens zum Teil hinreichend sicher erreichbar.<br />
Das sind aber nur 10% von den 40 000 Insekten-Arten Mitteleuropas.<br />
Dabei fällt auf, daß die für die Existenz der meisten<br />
Ökosysteme besonders bedeutsamen 8000 bis 9000 mittel-<br />
588