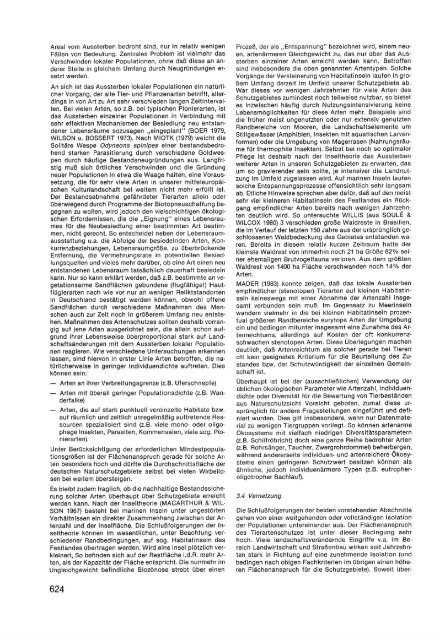Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Areal vom Aussterben bedroht sind, nur in relativ wenigen<br />
Fällen von Bedeutung. Zentrales Problem ist vielmehr das<br />
Verschwinden lokaler Populationen, ohne daß diese an anderer<br />
Stelle In gleichem Umfang durch Neugründungen ersetzt<br />
werden.<br />
An sich ist das Aussterben lokaler Populationen ein natürlicher<br />
Vorgang, der alle Tier- und Pf lanzenarten betrifft, allerdings<br />
in von Art zu Art sehr verschieden langen Zeitintervallen.<br />
Bei vielen Arten, so z.B. bei typischen Pionierarten, ist<br />
das Aussterben einzelner Populationen in Verbindung mit<br />
sehr effektiven Mechanismen der Besiedlung neu entstandener<br />
Lebensräume sozusagen „eingeplant" (BOER 1979,<br />
WILSON u. BOSSERT 1973). Nach MIOTK (1979) weicht die<br />
Solitäre Wespe Odyneons spinipes einer bestandsbedrohend<br />
starken Parasitierung durch verschiedene Goldwespen<br />
durch häufige Bestandsneugründungen aus. langfristig<br />
muß sich örtliches Verschwinden und die Gründung<br />
neuer Populationen in etwa die Waage halten, eine Voraussetzung,<br />
die für sehr vi ele Arten in unserer mitteleuropäischen<br />
Kulturlandschaft bei weitem nicht mehr erfüllt ist.<br />
Der Bestandsabnahme gefährdeter Tierarten allein oder<br />
überwiegend durch Programme der Biotopneuschaffung begegnen<br />
zu wollen, wird jedoch den vielschichtigen ökologischen<br />
Erfordernissen, die die „ Eignung" eines Lebensraumes<br />
für die Neubesiedlung einer bestimmten Art bestimmen,<br />
nicht gerecht. So entscheidet neben der Lebensraumausstattung<br />
u.a. die Abfolge der besiedelnden Arten, Konkurrenzbeziehungen,<br />
Lebensraumgröße, zu überbrückende<br />
Entfernung, die Vermehrungsrate in potentiellen Besledlungsquellen<br />
und vieles mehr darüber, ob eine Art einen neu<br />
entstandenen Lebensraum tatsächlich dauerhaft besiedeln<br />
kann. Nur so kann erklärt werden, daß z.B. bestimmte an vegetationsarme<br />
Sandflächen gebundene (flugfähige!) Hautflüglerarten<br />
nach wie vor nur an wenigen Rellktstandorten<br />
in Deutschland bestätigt werden können, obwohl offene<br />
Sandflächen durch verschiedene Maßnahmen des Menschen<br />
auch zur Zeit noch in größerem Umfang neu entstehen.<br />
Maßnahmen des <strong>Artenschutz</strong>es sollten deshalb vorrangig<br />
auf jene Arten ausgerichtet sein, die allein schon aufgrund<br />
ihrer Lebensweise überproportional stark auf Landschaftsänderungen<br />
mit dem Aussterben lokaler Populationen<br />
reagieren. Wie verschiedene Untersuchungen erkennen<br />
lassen, sind hiervon in erster Linie Arten betroffen, die natürlicherweise<br />
in geringer lndividuendichte auftreten. Dies<br />
können sein:<br />
- Arten an ihrer Verbreitungsgrenze (z.B. Uferschnepfe)<br />
- Arten mit überall geringer Populationsdichte (z.B. Wanderfalke)<br />
- Arten, die auf stark punktuell vereinzelte Habitate bzw.<br />
auf räumlich und zeitlich unregelmäßig auftretende Ressourcen<br />
spezialisiert sind (z.B. viele mono- oder oligophage<br />
Insekten, Parasiten, Kommensalen, viele sog. Pionlerarten).<br />
Unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestpopulationsgrößen<br />
ist der Flächenanspruch gerade für solche Arten<br />
besonders hoch und dürfte die Durchschnittsfläche der<br />
deutschen Naturschutzgebiete selbst bei vielen Wirbellosen<br />
bei weitem übersteigen.<br />
Es bleibt zudem fraglich, ob die nachhaltige Bestandssicherung<br />
solcher Arten überhaupt über Schutzgebiete erreicht<br />
werden kann. Nach der Inseltheorie (MACARTHUR & WIL<br />
SON 1967) besteht bei marinen Inseln unter ungestörten<br />
Verhältnissen ein direkter Zusammenhang zwischen der Artenzahl<br />
und der Inselfläche. Die Schlußfolgerungen der Inseltheorie<br />
können im wesentlichen, unter Beachtung verschiedener<br />
Randbedingungen, auf sog. Habitatinseln des<br />
Festlandes übertragen werden. Wird eine Insel plötzlich verkleinert,<br />
So befinden sich auf der Restfläche i.d.R. mehr Ar·<br />
ten, als der Kapazität der Fläche entspricht. Die nunmehr im<br />
Ungleichgewicht befindliche Biozönose strebt Ober einen<br />
Prozeß, der als „ Entspannung" bezeichnet wird, einem neu·<br />
en, artenärmeren Gleichgewicht zu, das nur Ober das Aussterben<br />
einzelner Arten erreicht werden kann. Betroffen<br />
sind insbesondere die oben genannten Artentypen. Solche<br />
Vorgänge der Verkleinerung von Habitatinseln laufen in großem<br />
Umfang derzeit im Umfeld unserer Schutzgebiete ab.<br />
War dieses vor wenigen Jahrzehnten für viele Arten des<br />
Schutzgebietes zumindest noch teilweise nutzbar, so bietet<br />
es inzwischen häufig durch Nutzungsintensivierung keine<br />
Lebensmöglichkeiten für diese Arten mehr. Beispiele sind<br />
die früher meist ungenutzten oder nur extensiv genutzten<br />
Randbereiche von Mooren, die Landschaftselemente um<br />
Stillgewässer (Amphibien, Insekten mit aquatischen Larvenformen)<br />
oder die Umgebung von Magerrasen (Nahrungsräume<br />
fü r thermophile Insekten). Selbst bei noch so optimaler<br />
Pflege ist deshalb nach der Inseltheorie das Aussterben<br />
weiterer Arten in unseren Schutzgebieten zu erwarten, das<br />
um so gravierender sei n sollte, je intensiver die Landnutzung<br />
im Umfeld zugelassen wird. Auf marinen Inseln laufen<br />
solche Entspannungsprozesse offensichtlich sehr langsam<br />
ab. Etliche Hinweise sprechen aber dafür, daß auf den meist<br />
sehr viel kleineren Habitatinseln des Festlandes ein Rückgang<br />
empfindlicher Arten bereits nach wenigen Jahrzehnten<br />
deutlich wird. So untersuchte WILLIS (aus SOULE &<br />
WILCOX 1980) 3 verschieden große Waldreste in Brasilien,<br />
die im Verlauf der letzten 150 Jahre aus der ursprünglich geschlossenen<br />
Waldbedeckung des Gebietes entstanden waren.<br />
Bereits in diesem relativ kurzen Zeitraum hatte der<br />
kleinste Waldrest von immerhin noch 21 ha Größe 62% seiner<br />
ehemaligen Brutvogelfauna verloren. Aus dem größten<br />
Waldrest von 1400 ha Fläche verschwanden noch 14% der<br />
Arten.<br />
MADER (1983) konnte zeigen, daß das lokale Aussterben<br />
empfindlicher (stenotoper) Tierarten auf kleinen Habitatinseln<br />
keineswegs mit einer Abnahme der Artenzahl insgesamt<br />
verbunden sein muß. Im Gegensatz zu Meerinseln<br />
wandern vielmehr in die bei kleinen Habitatinseln prozentual<br />
größeren Randbereiche eurytope Arten der Umgebung<br />
ein und bedingen mitunter insgesamt eine Zunahme des Artenreichtums,<br />
allerdings auf Kosten der oft konkurrenzschwachen<br />
stenotopen Arten. Diese Überlegungen machen<br />
deutlich, daß Artenreichtum als solcher gerade bei Tieren<br />
oft kein geeignetes Kriterium für die Beurteilung des Zustandes<br />
bzw. der Schutzwürdigkeit der einzelnen Gemeinschaft<br />
ist.<br />
Überhaupt ist bei der (ausschließlichen) Verwendung der<br />
üblichen ökologischen Parameter wie Artenzahl, Individuendichte<br />
oder Diversität für die Bewertung von Tierbeständen<br />
aus Naturschutzsicht Vorsicht geboten, zumal diese ursprünglich<br />
für andere Fragestellungen eingeführt und definiert<br />
wurden. Dies gilt insbesondere, wenn nur Datenmaterial<br />
zu wenigen Tiergruppen vorliegt. So können artenarme<br />
Ökosysteme mit vielfach niedrigen Dlversitätsparametern<br />
(z.B. Schilfröhricht) doch eine ganze Reihe bedrohter Arten<br />
(z. B. Rohrsänger, Taucher, Zwergrohrdommel) beherbergen,<br />
während andererseits individuen- und artenreichere Ökosysteme<br />
einen geringeren Schutzwert besitzen können als<br />
ähnliche, jedoch individuenärmere Typen (z.B. eutropheroligotropher<br />
Bachlauf).<br />
3.4 Vernetzung<br />
Die Schlußfolgerungen der beiden vorstehenden Abschnitte<br />
gehen von einer weitgehenden oder vollst ändigen Isolation<br />
der Populationen untereinander aus. Der Flächenanspruch<br />
des Tierartenschutzes ist unter dieser Bedingung sehr<br />
hoch. Viele landschaftsverändernde Eingriffe v.a. im Be·<br />
reich Landwirtschaft und Straßenbau wirken seit Jahrzehnten<br />
stark in Richtung auf ei ne zunehmende Isolation (und<br />
bedingen nach obigen Fachkriterien im übrigen einen höheren<br />
Flächenanspruch für die Schutzgebiete). Soweit über-<br />
624