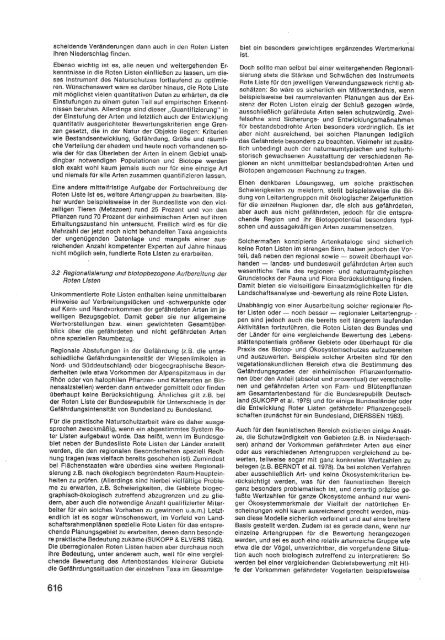Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
scheidende Veränderungen dann auch in den Roten Listen<br />
ihren Niederschlag finden.<br />
Ebenso wichtig ist es, alle neuen und weitergehenden Er·<br />
kenntnisse in die Roten Listen einfließen zu lassen, um dieses<br />
Instrument des Naturschutzes fortlaufe.nd zu optimieren.<br />
Wünschenswert wäre es darüber hinaus, die Rote Liste<br />
mit möglichst vielen quantitativen Daten zu erhärten, da die<br />
Einstufungen zu einem guten Teil auf empirischen Erkenntnissen<br />
beruhen. Allerdings sind dieser „ Quantifizierung" in<br />
der Einstufung der Arten und letztlich auch der Entwicklung<br />
quantitativ ausgerichteter Bewertungskriterien enge Grenzen<br />
gesetzt, die in der Natur der Objekte liegen: Kriterien<br />
wie Bestandsentwicklung, Gefährdung, Größe und räumli·<br />
ehe Verteilung der ehedem und heute noch vorhandenen sowie<br />
der für das Überleben der Arten in einem Gebiet unabdingbar<br />
notwendigen Populationen und Biotope werden<br />
sich exakt wohl kaum jemals auch nur für eine einzige Art<br />
und niemals für alle Arten zusammen quantifizieren lassen.<br />
Eine andere mittelfristige Aufgabe der Fortschreibung der<br />
Roten Liste Ist es, weitere Artengruppen zu bearbeiten. Bisher<br />
wurden beispielsweise in der Bundesliste von den vielzelligen<br />
Tieren (Metazoen) rund 25 Prozent und von den<br />
Pflanzen rund 70 Prozent der einheimischen Arten auf ihren<br />
Erhaltungszustand hin untersucht. Freilich wird es für die<br />
Mehrzahl der jetzt noch nicht behandelten Taxa angesichts<br />
der ungenügenden Datenlage und mangels einer ausreichenden<br />
Anzahl kompetenter Experten auf Jahre hinaus<br />
nicht möglich sein, fundierte Rote Listen zu erarbeiten.<br />
3.2 Regionalisierung und biotopbezogene Aufbereitung der<br />
Roten Listen<br />
Unkommentierte Rote Listen enthalten keine unmittelbaren<br />
Hinweise auf Verbreitungslücken und -schwerpunkte oder<br />
auf Kern- und Randvorkommen der gefährdeten Arten im jeweiligen<br />
Bezugsgebiet. Damit geben sie nur allgemeine<br />
Wertvorstellungen bzw. einen gewichteten Gesamtoberblick<br />
Ober die gefährdeten und nicht gefährdeten Arten<br />
ohne speziellen Raumbezug.<br />
Regionale Abstufungen In der Gefährdung (z.B. die unterschiedliche<br />
Gefährdungsintensität der Wiesenlimikolen in<br />
Nord· und Süddeutschland) oder biogeographische Besonderheiten<br />
(wie etwa Vorkommen der Alpenspitzmaus in der<br />
Rhön oder von halophilen Pflanzen- und Käferarten an Bin·<br />
nensalzstellen) werden dann entweder gemittelt oder finden<br />
Oberhaupt keine Berücksichtigung. Ähnliches gilt z.B. bei<br />
der Roten Liste der Bundesrepublik für Unterschiede in der<br />
Gefährdungsintensität von Bundesland zu Bundesland.<br />
Für die praktische Naturschutzarbeit wäre es daher ausgesprochen<br />
zweckmäßig, wenn ein abgestimmtes System Roter<br />
Listen aufgebaut würde. Das heißt, wenn im Bundesgebiet<br />
neben der Bundesliste Rote Listen der Länder erstellt<br />
werden, die den regionalen Besonderheiten speziell Rechnung<br />
tragen (was vielfach bereits geschehen ist). Zumindest<br />
bei Flächenstaaten wäre überdies eine weitere Regionalisierung<br />
z.B. nach ökologisch begründeten Raum-Haupteinheiten<br />
zu prüfen. (Allerdings sind hierbei vielfältige Probleme<br />
zu erwarten, z.B. Schwierigkeiten, die Gebiete biogeographisch-ökologisch<br />
zutreffend abzugrenzen und zu gliedern,<br />
aber auch die notwendige Anzahl qualifizierter Mitarbeiter<br />
für ein solches Vorhaben zu gewinnen u.a.m.) Letztendlich<br />
ist es sogar wünschenswert, im Vorfeld von Landschaftsrahmenplänen<br />
spezielle Rote Listen für das ent sprechende<br />
Planungsgebiet zu erarbeiten, denen dann besonde·<br />
re praktische Bedeutung zukäme (SUKOPP & ELVERS 1982).<br />
Die überregionalen Roten Listen haben aber durchaus noch<br />
ihre Bedeutung, unter anderem auch, weil für eine verglei·<br />
chende Bewertung des Artenbestandes kleinerer Gebiete<br />
die Gefährdungssituation der einzelnen Taxa im Gesamtge-<br />
biet ein besonders gewichtiges ergänzendes Wertmerkmal<br />
ist.<br />
Doch sollte man selbst bei einer weitergehenden Regionalisierung<br />
stets die Stärken und Schwächen des Instruments<br />
Rote Liste für den jeweiligen Verwendungszweck richtig abschätzen:<br />
So wäre es sicherlich ein Mißverständnis, wenn<br />
beispielsweise bei raumrelevanten Planungen aus der Existenz<br />
der Roten Listen einzig der Schluß gezogen würde,<br />
ausschließlich gefährdete Arten seien schutzwürdig. zweifelsohne<br />
sind Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
für bestandsbedrohte Arten besonders vordringlich. Es ist<br />
aber nicht ausreichend, bei solchen Planungen lediglich<br />
das Gefährdete besonders zu beachten. Vielmehr ist zusätzlich<br />
unbedingt auch der naturraumtyplschen und kulturhi·<br />
storisch gewachsenen Ausstattung der verschiedenen Regionen<br />
an nicht unmittelbar bestandsbedrohten Arten und<br />
Biotopen angemessen Rechnung zu tragen.<br />
Einen denkbaren Lösungsweg, um solche praktischen<br />
Schwierigkeiten zu meistern, stellt beispielsweise die Bil·<br />
dung von Leitartengruppen mit ökologischer Zeigerfunktion<br />
für die einzelnen Regionen dar, die sich aus gefährdeten,<br />
aber auch aus nicht gefährdeten, jedoch für die entsprechende<br />
Region und ihr Biotoppotential besonders typischen<br />
und aussagekräftigen Arten zusammensetzen.<br />
Solchermaßen konzipierte Artenkataloge sind sicherlich<br />
keine Roten Listen im strengen Sinn, haben jedoch den Vorteil,<br />
daß neben den regional sowie - soweit Oberhaupt vorhanden<br />
- landes- und bundesweit gefährdeten Arten auch<br />
wesentliche Teile des regionen- und naturraumtypischen<br />
Grundstocks der Fauna und Flora Berücksichtigung finden.<br />
Damit bieten sie vielseitigere Einsatzmöglichkeiten fü r die<br />
Landschaftsanalyse und -bewertung als rei ne Rote Listen.<br />
Unabhängig von einer Ausarbeitung solcher regionaler Roter<br />
Listen oder - noch besser - regionaler Leitartengrup- •<br />
pen sind jedoch auch die bereits seit längerem laufenden<br />
Aktivitäten fortzuführen, die Roten Listen des Bundes und<br />
der Länder für eine vergleichende Bewertung des Lebensstättenpotentials<br />
größerer Gebiete oder Oberhaupt für die<br />
Praxis des Biotop- und Ökosystemschutzes aufzubereiten<br />
und auszuwerten. Beispiele solcher Arbeiten sind für den<br />
vegetationskundlichen Bereich etwa die Bestimmung des<br />
Gefährdungsgrades der einheimischen Pflanzenformationen<br />
über den Anteil (absolut und prozentual) der verschollenen<br />
und gefährdeten Arten von Farn- und Blütenpflanzen<br />
am Gesamtartenbestand für die Bundesrepublik Deutsch·<br />
land (SUKOPP et al. 1978) und für einige Bundesländer oder<br />
die Entwicklung Roter Listen gefährdeter Pflanzengesellschaften<br />
(zunächst für ein Bundesland, DIERSSEN 1983).<br />
Auch für den faunistischen Bereich existieren einige Ansätze,<br />
die Schutzwürdigkeit von Gebieten (z. B. in Niedersachsen)<br />
anhand der Vorkommen gefährdeter Arten aus einer<br />
oder aus verschiedenen Artengruppen vergleichend zu bewerten,<br />
teilweise sogar mit ganz konkreten Wertzahlen zu<br />
belegen (z.B. BERNDT et al. 1978). Da bei solchen Verfahren<br />
aber ausschließlich Art- und keine Ökosystemkriterien berücksichtigt<br />
werden, was für den faunistischen Bereich<br />
ganz besonders problematisch ist, und derartig präzise gefaßte<br />
Wertzahlen für ganze Ökosysteme anhand nur weniger<br />
Ökosystemmerkmale der Vielfalt der natürlichen Er·<br />
schelnungen wohl kaum ausreichend gerecht werden, müs·<br />
sen diese Modelle sicherlich verfeinert und auf eine breitere<br />
Basis gestellt werden. Zudem ist es gerade dann, wenn nur<br />
einzelne Artengruppen fü r die Bewertung herangezogen<br />
werden, und sei es auch.eine relativ artenreiche Gruppe wie<br />
etwa die der Vögel, unverzichtbar, die vorgefundene Situation<br />
auch noch biologisch zutreffend zu interpretieren: So<br />
werden bei einer vergleichenden Gebiet sbewertung mit Hilfe<br />
der Vorkommen gefährdeter Vogelarten beispielsweise<br />
616