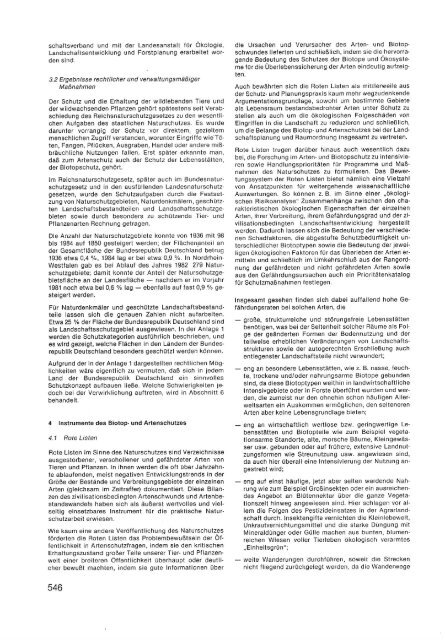Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schaftsverband und mit der Landesanstalt für Ökologie,<br />
Landschaftsentwicklung und Forstplanung erarbeitet wor·<br />
den sind.<br />
3.2 Ergebnisse rechtlicher und verwaltungsmäßiger<br />
Maßnahmen<br />
Der Schutz und die Erhaltung der wildlebenden Tiere und<br />
der wildwachsenden Pflanzen gehört spätestens seit Verab·<br />
schiedung des Reichsnaturschutzgesetzes zu den wesentli·<br />
chen Aufgaben des staatlichen Naturschutzes. Es wurde<br />
darunter vorrangig der Schutz vor direktem, gezieltem<br />
menschlichen Zugriff verstanden, worunter Eingriffe wie"Tö·<br />
ten, Fangen, Pflücken, Ausgraben, Handel oder andere miß·<br />
bräuchliche Nutzungen fallen. Erst später erkannte man,<br />
daß zum <strong>Artenschutz</strong> auch der Schutz der Lebensstätten,<br />
der Biotopschutz, gehört.<br />
Im Reichsnaturschutzgesetz, später auch im Bundesnaturschutzgesetz<br />
und in den ausfüllenden Landesnaturschutz·<br />
gesetzen, wurde den Schutzaufgaben durch die Festset·<br />
zung von Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern, geschützten<br />
Landschaftsbestandteilen und Landschaftsschutzgebieten<br />
sowie durch besonders zu schützende Tier- und<br />
Pflanzenarten Rechnung getragen.<br />
Die Anzahl der Naturschutzgebiete konnte von 1936 mit 98<br />
bis 1984 auf 1850 gesteigert werden; der Flächenanteil an<br />
der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland betrug<br />
1936 etwa 0,4 % , 1984 lag er bei etwa 0,9 %. In Nordrhein<br />
Westfalen gab es bei Ablauf des Jahres 1982 279 Natur·<br />
schutzgebiete; damit konnte der Anteil der Naturschutzgebietsfläche<br />
an der Landesfläche - nachdem er im Vorjahr<br />
1981 noch etwa bei 0,6 % lag - ebenfalls auf fast 0,9 % ge·<br />
steigert werden.<br />
Für Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestand·<br />
teile lassen sich die genauen Zahlen nicht aufarbeiten.<br />
Etwa 25 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland sind<br />
als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. In der Anlage 1<br />
werden die Schutzkategorien ausführlich beschrieben, und<br />
es wird gezeigt, welche Flächen in den Ländern der Bundesrepublik<br />
Deutschland besonders geschützt werden können.<br />
Aufgrund der in der Anlage 1 dargestellten rechtlichen Möglichkeiten<br />
wäre eigentlich zu vermuten, daß sich in jedem<br />
Land der Bundesrepublik Deutschland ein sinnvolles<br />
Schutzkonzept aufbauen ließe. Welche Schwierigkeiten jedoch<br />
bei der Verwirklichung auftreten, wird in Abschnitt 6<br />
behandelt.<br />
4 Instrumente des Biotop· und <strong>Artenschutz</strong>es<br />
4. 1 Rote Listen<br />
Rote Listen im Sinne des Naturschutzes sind Verzeichnisse<br />
ausgestorbener, verschollener und gefährdeter Arten von<br />
Tieren und Pflanzen. In ihnen werden die oft über Jahrzehnte<br />
ablaufenden, meist negativen Entwicklungstrends in der<br />
Größe der Bestände und Verbreitungsgebiete der einzelnen<br />
Arten (gleichsam im Zeitraffer) dokumentiert. Diese Bilanzen<br />
des zivilisationsbedingten Artenschwunds und Artenbestandswandels<br />
haben sich als äußerst wertvolles und vielseitig<br />
einsetzbares Instrument für die praktische Naturschutzarbeit<br />
erwiesen.<br />
Wie kaum eine andere Veröffentlichung des Naturschutzes<br />
förderten die Roten Listen das Problembewußtsein der Öffentlichkeit<br />
in <strong>Artenschutz</strong>fragen, indem sie den kritischen<br />
Erhalt ungszustand großer Teile unserer Tier- und Pf lanzen·<br />
weit einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt oder deutlicher<br />
bewußt machten, indem sie gute Informationen Ober<br />
die Ursachen und Verursacher des Arten- und Biotop·<br />
schwundes lieferten und schließlich, indem sie die hervorragende<br />
Bedeutung des Schutzes der Biotope und Ökosyste·<br />
me für die Überlebenssicherung der Arten eindeutig aufzeigten.<br />
Auch bewährten sich die Roten Listen als mittlerweile aus<br />
der Schutz- und Planungspraxis kaum mehr wegzudenkende<br />
Argumentationsgrundlage, sowohl um bestimmte Gebiete<br />
als Lebensraum bestandsbedrohter Arten unter Schutz zu<br />
stellen als auch um die ökologischen Folgeschäden von<br />
Eingriffen in die Landschaft zu reduzieren und schließlich,<br />
um die Belange des Biotop· und <strong>Artenschutz</strong>es bei der Land·<br />
schaftsplanung und Raumordnung insgesamt zu vertreten.<br />
Rote Listen trugen darüber hinaus auch wesentlich dazu<br />
bei , die Forschung im Arten- und Biotopschutz zu intensivieren<br />
sowie Handlungsprioritäten für Programme und Maßnahmen<br />
des Naturschutzes zu formulieren. Das Bewertungssystem<br />
der Roten Listen bietet nämlich eine Vielzahl<br />
von Ansatzpunkten für weitergehende wissenschaftliche<br />
Auswertungen. So können z. B. im Sinne einer „ökologischen<br />
Risikoanalyse" zusammenhänge zwischen den charakteristischen<br />
ökologischen Eigenschaften der einzelnen<br />
Arten, ihrer Verbreit ung, ihrem Gefährdungsgrad und der zivilisationsbedingten<br />
Landschaftsentwicklung hergestellt<br />
werden. Dadurch lassen sich die Bedeutung der verschiedenen<br />
Schadfaktoren, die abgestufte Schutzbedürftigkeit un·<br />
terschiedlicher Biotoptypen sowie die Bedeutung der jeweiligen<br />
ökologischen Faktoren für das Überleben der Arten ermitteln<br />
und schließlich im Umkehrschluß aus der Rangordnung<br />
der gefährdeten und nicht gefährdeten Arten sowie<br />
aus den Gefährdungsursachen auch ein Prioritätenkatalog<br />
für Schutzmaßnahmen festlegen.<br />
Insgesamt gesehen fi nden sich dabei auffal lend hohe Ge·<br />
fährdungsraten bei solchen Arten, die<br />
- große, strukturreiche und störungsfreie Lebensstätten<br />
benötigen, was bei der Seltenheit solcher Räume als Folge<br />
der geänderten Formen der Bodennutzung und der<br />
teilweise erheblichen Veränderungen von Landschaftsstrukturen<br />
sowie der autogerechten Erschließung auch<br />
entlegenster Landschaftsteile nicht verwundert;<br />
- eng an besondere Lebensstätten, wie z. B. nasse, feuchte,<br />
trockene und/oder nahrungsarme Biotope gebunden<br />
sind, da diese Biotoptypen weithin in landwirtschaft liche<br />
lntensivgebiete oder in Forste überfü hrt wurden und werden,<br />
die zumeist nur den ohnehin schon häufigen Aller·<br />
weltsarten ein Auskommen ermöglichen, den selteneren<br />
Arten aber keine Lebensgrundlage bieten;<br />
- eng an wirtschaftlich wert lose bzw. geringwertige Lebensstätten<br />
und Biotopteile wie zum Beispiel vegeta·<br />
tionsarme Standorte, alte, morsche Bäume, Kleingewäs·<br />
ser usw. gebunden oder auf frühere, extensive Landnutzungsformen<br />
wie Streunutzung usw. angewiesen sind,<br />
da auch hier überall eine Intensivierung der Nutzung angestrebt<br />
wird ;<br />
- eng auf einst häufige, jetzt aber selten werdende Nahrung<br />
wie zum Beispiel Großinsekten oder ein ausreichendes<br />
Angebot an Blütennektar über die ganze Vegeta·<br />
tionszeit hinweg angewiesen sind. Hier schlagen vor allem<br />
die Folgen des Pestizideinsatzes in der Agrarlandschaft<br />
durch. Insektengifte vern ichten die Kleinlebewelt,<br />
Unkrautvernichtungsmittel und die starke Düngung mit<br />
Mineraldünger oder Gülle machen aus bunten, blumenreichen<br />
Wiesen voller Tierleben ökologisch verarmtes<br />
„Einheitsgrün";<br />
- weite Wanderungen du rchführen, soweit die Strecken<br />
nicht fliegend zurückgelegt werden, da die Wanderwege<br />
546