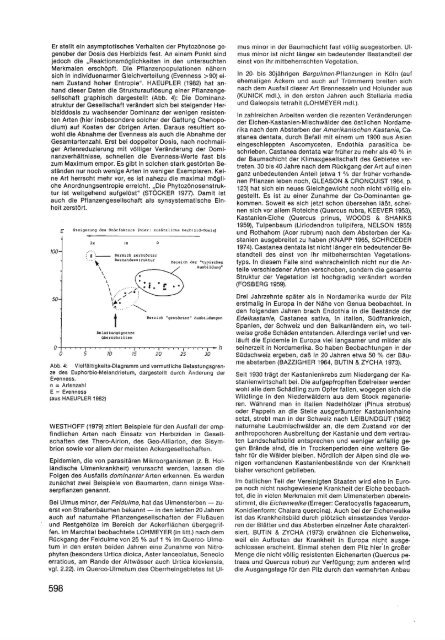Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Er stellt ein asymptotisches Verhalten der Phytozönose gegenüber<br />
der Dosis des Herbizids fest. An einem Punkt sind<br />
jedoch die „ Reaktlonsmöglichk.eiten in den untersuchten<br />
Merkmalen erschöpft. Die Pflanzenpopulationen nähern<br />
sich In individuenarmer Gleichverteilung (Evenness >90) einem<br />
Zustand hoher Entropie". HAEUPLER (1982) hat anhand<br />
dieser Daten die Strukturauflösung einer Pflanzenge·<br />
sellschaft graphisch dargestellt (Abb. 4): Die Domlnanzstruktur<br />
der Gesellschaft verändert sich bei steigender Herblzlddosis<br />
zu wachsender Dominanz der wenigen resistenten<br />
Arten (hier insbesondere solcher der Gattung Chenopodium)<br />
auf Kosten der übrigen Arten. Daraus resultiert sowohl<br />
die Abnahme der Evenness als auch die Abnahme der<br />
Gesamtartenzahl. Erst bei doppelter Dosis, nach nochmali·<br />
ger Artenreduzierung mit völliger Veränderung der Domi·<br />
nanzverhältnisse, schnellen die Evenness-Werte fast bis<br />
zum Maximum empor. Es gibt in solchen stark gestörten Be·<br />
ständen nur noch wenige Arten in wenigen Exemplaren. Kei·<br />
ne Art herrscht mehr vor, es ist nahezu die maximal mögli·<br />
ehe Anordnungsentropie erreicht. „ Die Phytozönosenstruk·<br />
tur ist weitgehend aufgelöst" (STÖCKER 1977). Damit ist<br />
auch die Pflanzengesellschaft als synsystematische Ein·<br />
heil zerstört.<br />
100<br />
50<br />
E<br />
S t e i 9erun9 das S t l>rhktors (hier: zus4tzliche Kerbizid· Do1h)<br />
2x l x 0<br />
:·.·.·§.· .· :·~-- Bere i ch zerstört.er<br />
~ Bestandes s trw.;tur<br />
\<br />
\<br />
\<br />
\ ·; .„ ..<br />
\ .·· ,,,,.. .<br />
\ „..... ; ,.,. ;<br />
\:.....: .„„<br />
""··· · „ "'-<br />
t<br />
Belas t un9s 9renze<br />
llberschri t ten<br />
. .<br />
Bereich der "typische n<br />
Ausbildung"<br />
Bereich "9estOcterN Au1bildun9on<br />
o -+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-n<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Abb. 4: Vielfältigkelts-Diagramm und vermutliche Belastungsgren·<br />
ze des Euphorbio-Melandrietum, dargestellt durch Änderung der<br />
Evenness.<br />
n = Artenzahl<br />
E = Evenness<br />
(aus HAEUPLER 1982)<br />
WESTHOFF (1979) zitiert Beispiele für den Ausfall der empfindlichen<br />
Arten nach Einsatz von Herbiziden in Gesellschaften<br />
des Thero-Airion, des Geo-Alliarion, des Sisymbrion<br />
sowie vor allem der meisten Ackergesellschaften.<br />
Epidemien, die von parasitären Mikroorganismen (z. B. Holländische<br />
Ulmenkrankheit) verursacht werden, lassen die<br />
Folgen des Ausfalls dominanter Arten erkennen. Es werden<br />
zunächst zwei Beispiele von Baumarten, dann einige Wasserpflanzen<br />
genannt.<br />
Bei Ulmus minor, der Feldulme, hat das Ulmensterben - zu.<br />
erst von Straßenbäumen bekannt - in den letzten 20 Jahren<br />
auch auf naturnahe Pflanzengesellschaften der Flußauen<br />
und Restgehölze im Bereich der Ackerflächen übergegrif·<br />
fen. Im Marchtal beobachtete LOH MEYER (in litt.) nach dem<br />
Rückgang der Feldulme von 25 % auf 1 % im Querco- Ulmetum<br />
in den ersten beiden Jahren eine Zunahme von Nitrophyten<br />
(besonders Urtica dioica, Aster lanceolatus, Senecio<br />
erraticus, am Rande der Altwässer auch Urtlca kioviensis,<br />
vgl. 2.22). Im Querco-Ulmetum des Oberrheingebietes ist UI·<br />
mus minor in der Baumschicht fast vö llig ausgestorben. UI·<br />
mus minor ist nicht länger ein bedeutender Bestandteil der<br />
einst von ihr mitbeherrschten Vegetation.<br />
In 20- bis 30jährigen Bergulmen-Pflanzungen in Köln (auf<br />
ehemaligen Äckern und auch auf Trümmern) breiten sich<br />
nach dem Ausfall dieser Art Brennesseln und Holunder aus<br />
(KUNICK mdl.), in den ersten Jahren auch Stellaria media<br />
und Galeopsis tetrahit (LOH MEYER mdl.).<br />
In zahlreichen Arbeiten werden die rezenten Veränderungen<br />
der Eichen-Kastanien-Mischwälder des östlichen Nordamerika<br />
nach dem Absterben der Amerikanischen Kastanie, Ca·<br />
stanea dentata, durch Befall mit einem um 1900 aus Asien<br />
eingeschleppten Ascomyceten, Endothia parasitica be·<br />
schrieben. Castanea dentata war früher zu mehr als 40 % in<br />
der Baumschicht der Klimaxgesellschaft des Gebietes vertreten.<br />
30 bis 40 Jahre nach dem Rückgang der Art auf einen<br />
ganz unbedeutenden Anteil (etwa 1 % der früher vorhandenen<br />
Pflanzen leben noch, GLEASON & CRONQUIST 1964, p.<br />
123) hat sich ein neues Gleichgewicht noch nicht völlig eingestellt.<br />
Es ist zu einer Zunahme der Co-Dominanten ge·<br />
kommen. Soweit es sich jetzt schon übersehen läßt, scheinen<br />
sich vor allem Roteiche (Quercus rubra, KEEVER 1953),<br />
Kastanien-Eiche (Quercus prinus, WOODS & SHANKS<br />
1959), Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera, NELSON 1955)<br />
und Rothahorn (Acer rubrum) nach dem Absterben der Ka·<br />
stanien ausgebreitet zu haben (KNAPP 1965, SCHROEDER<br />
1974). Castanea dentata ist nicht länger ein bedeutender Be·<br />
standteil des einst von ihr mitbeherrschten Vegetationstyps.<br />
In diesem Falle sind wahrscheinlich nicht nur die An·<br />
teile verschiedener Arten verschoben, sondern die gesamte<br />
Struktur der Vegetation ist hochgradig verändert worden<br />
(FOSBERG 1959).<br />
Drei Jahrzehnte später als in Nordamerika wurde der Pilz<br />
erstmalig in Europa in der Nähe von Genua beobachtet. In<br />
den folgenden Jahren brach Endothia in die Bestände der<br />
Edelkastanie, Castanea sat iva, in Italien, Südfrankreich,<br />
Spanien, der Schweiz und den Balkanländern ein, wo teil·<br />
weise große Schäden entstanden. Allerdings verlief und ver·<br />
läuft die Epidemie in Europa viel langsamer und milder als<br />
seinerzeit in Nordamerika. So haben Beobachtungen in der<br />
Südschweiz ergeben, daß in 20 Jahren etwa 50 % der Bäume<br />
abstarben (BAZZIGHER 1964, BUTIN & ZYCHA 1973).<br />
Seit 1930 trägt der Kastanienkrebs zum Niedergang der Kastanienwirtschaft<br />
bei. Die aufgepfropften Edelreiser werden<br />
wohl alle dem Schädling zum Opfer fallen, wogegen sich die<br />
Wildlinge in den Niederwäldern aus dem Stock regenerieren.<br />
Während man in Italien Nadelhölzer (Pinus strobus)<br />
oder Pappeln an die Stelle ausgeräumter Kastanienhaine<br />
setzt, strebt man in der Schweiz nach LEIBUNDGUT (1962)<br />
naturnahe Laubmischwälder an, die dem Zustand vor der<br />
anthropochoren Ausbreitung der Kastanie und dem vertrauten<br />
Landschaftsbild entsprechen und weniger anfällig gegen<br />
Brän de sind, die in Trockenperioden eine weitere Ge·<br />
fahr für die Wälder bleiben. Nördlich der Alpen sind die wenigen<br />
vorhandenen Kastanienbestände von der Krankheit<br />
bisher verschont geblieben.<br />
Im östlichen Teil der Vereinigten Staaten wird eine in Europa<br />
noch nicht nachgewiesene Krankheit der Eiche beobachtet,<br />
die in vielen Merkmalen mit dem Ulmensterben überein·<br />
stimmt, die Eichenwelke (Erreger: Ceratocystis fagacearum,<br />
Konidienform: Chalara quercina). Auch bei der Eichenwelke<br />
ist das Krankheitsbild durch plötzlich einsetzendes Verdorren<br />
der Blätter und das Absterben einzelner Äste charakterisiert.<br />
BUTIN & ZYCHA (1973) erwähnen die Eichenwelke,<br />
weil ein Auftreten der Krankheit in Europa nicht ausgeschlossen<br />
erscheint. Einmal stehen dem Pilz hier'in großer<br />
Menge die nicht völlig resistenten Eichenarten (Quercus petraea<br />
und Quercus robur) zur Verfügung; zum anderen wird<br />
die Ausgangslage für den Pilz durch den vermehrten Anbau<br />
598