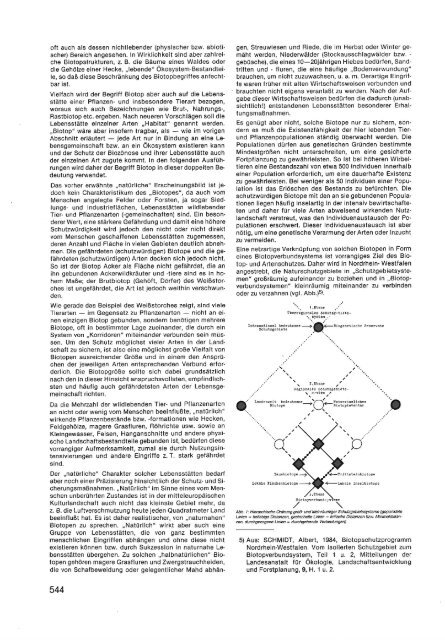Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Warum Artenschutz? - Deutscher Rat für Landespflege
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
oft auch als dessen nichtlebender (physischer bzw. abioti·<br />
scher) Bereich angesehen. In Wirklichkeit sind aber zahlreiche<br />
Biotopstrukturen, z. B. die Bäume eines Waldes oder<br />
die Gehölze einer Hecke, „lebende" Ökosystem-Bestandteile,<br />
so daß diese Beschränkung des Biotopbegriffes anfecht·<br />
bar ist.<br />
Vielfach wird der Begriff Biotop aber auch auf die Lebensstätte<br />
einer Pflanzen· und insbesondere Tierart bezogen,<br />
woraus sich auch Bezeichnungen wie Brut-, Nahrungs·,<br />
Rastbiotop etc. ergeben. Nach neueren Vorschlägen soll die<br />
Lebensstätte einzelner Arten „Habitat" genannt werden.<br />
„Biotop" wäre aber insofern tragbar, als - wie im vorigen<br />
Abschnitt erläutert - jede Art nur in Bindung an eine Lebensgemeinschaft<br />
bzw. an ein Ökosystem existieren kann<br />
und der Schutz der Biozönose und ihrer Lebensstätte auch<br />
der einzelnen Art zugute kommt. In den folgenden Ausfüh·<br />
rungen wird daher der Begriff Biotop in dieser doppelten Be·<br />
deutung verwendet.<br />
Das vorher erwähnte „natürliche" Erscheinungsbild ist jedoch<br />
kein Charakteristikum des „Biotopes", da auch vom<br />
Menschen angelegte Felder oder Forsten, ja sogar Sied·<br />
lungs- und Industrieflächen, Lebensstätten wildlebender<br />
Tier· und Pflanzenarten (·gemeinschaften) sind. Ein beson·<br />
derer Wert, eine stärkere Gefährdung und damit eine höhere<br />
Schutzwürdigkeit wird jedoch den nicht oder nicht direkt<br />
vom Menschen geschaffenen Lebensstätten zugemessen,<br />
deren Anzahl und Fläche in vielen Gebieten deutlich abnehmen.<br />
Die gefährdeten (schutzwürdigen) Biotope und die ge·<br />
fährdeten (schutzwürdigen) Arten decken sich jedoch nicht.<br />
So ist der Biotop Acker als Fläche nicht gefährdet, die an<br />
ihn gebundenen Ackerwildkräuter und ·tiere sind es in hohem<br />
Maße; der Brutbiotop (Gehöft, Dörfer) des Weißstor·<br />
ches ist ungefährdet, die Art ist jedoch weithin verschwun·<br />
den.<br />
Wie gerade das Beispiel des Weißstorches zeigt, sind viele<br />
Tierarten - im Gegensatz zu Pflanzenarten - nicht an einen<br />
einzigen Biotop gebunden, sondern benötigen mehrere<br />
Biotope, oft in bestimmter Lage zueinander, die durch ein<br />
System von „ Korridoren" miteinander verbunden sein müs·<br />
sen. Um den Schutz möglichst vieler Arten in der Land·<br />
schaft zu sichern, ist also eine möglichst große Vielfalt von<br />
Biotopen ausreichender Größe und in einem den Ansprüchen<br />
der jeweiligen Arten entsprechenden Verbund erforderlich.<br />
Die Biotopgröße sollte sich dabei grundsätzlich<br />
nach den in dieser Hinsicht anspruchsvollsten, empfindlich·<br />
sten und häufig auch gefährdetsten Arten der Lebensge·<br />
meinschaft richten.<br />
Da die Mehrzahl der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten<br />
an nicht oder wenig vom Menschen beeinflußte, „natürlich"<br />
wirkende Pflanzenbestände bzw. -formationen wie Hecken,<br />
Feldgehölze, magere Grasfluren, Röhrichte usw. sowie an<br />
Kleingewässer, Felsen, Hanganschnitte und andere physische<br />
Landschaftsbestandteile gebunden ist, bedürfen diese<br />
vorrangiger Aufmerksamkeit, zumal sie durch Nutzungsintensivierungen<br />
und andere Eingriffe z. T. stark gefährdet<br />
sind.<br />
Der „ natürliche" Charakter solcher Lebensstätten bedarf<br />
aber noch einer Präzisierung hinsichtlich der Schutz· und Si·<br />
cherungsmaßnahmen. „ Natürlich" im Sinne eines vom Men·<br />
sehen unberührten Zustandes ist in der mitteleuropäischen<br />
Kulturlandschaft auch nicht das kleinste Gebiet mehr, da<br />
z. B. die Luftverschmutzung heute jeden Quadratmeter Land<br />
beeinflußt hat. Es ist daher realistischer, von „naturnahen"<br />
Biotopen zu sprechen. „Natürlich" wirkt aber auch eine<br />
Gruppe von Lebensstätten, die von ganz bestimmten<br />
menschlichen Eingriffen abhängen und ohne diese nicht<br />
existieren können bzw. durch Sukzession in naturnahe Le·<br />
bensstätten übergehen. Zu solchen „halbnatürlichen" Biotopen<br />
gehören magere Grasfluren und Zwergstrauchheiden,<br />
die von Schafbeweidung oder gelegentlicher Mahd abhän·<br />
gen, Streuwiesen und Riede, die im Herbst oder Winter gemäht<br />
werden, Niederwälder (Stockausschlagwälder bzw. -<br />
gebüsche), die eines 10-20jährigen Hiebes bedürfen, Sand·<br />
triften und - fluren, die eine häufige „Bodenverwundung"<br />
brauchen, um nicht zuzuwachsen, u. a. m. Derartige Eingriffe<br />
waren früher mit alten Wirtschaftsweisen verbunden und<br />
brauchten nicht eigens veranlaßt zu werden. Nach der Aufgabe<br />
dieser Wirtschaftsweisen bedürfen die dadurch (unabsichtlich!)<br />
entstandenen Lebensstätten besonderer Erhaltungsmaßnahmen.<br />
Es genügt aber nicht, solche Biotope nur zu sichern, sondern<br />
es muß die Existenzfähigkeit der hier lebenden Tier·<br />
und Pflanzenpopulationen ständig überwacht werden. Die<br />
Populationen dürfen aus genetischen Gründen bestimmte<br />
Mindestgrößen nicht unterschreiten, um eine gesicherte<br />
Fortpflanzung zu gewährleisten. So ist bei höheren Wirbel·<br />
tieren eine Bestandszahl von etwa 500 Individuen innerhalb<br />
einer Population erforderlich, um eine dauerhafte Existenz<br />
zu gewährleisten. Bei weniger als 50 Individuen einer Popu·<br />
lation ist das Erlöschen des Bestands zu befürchten. Die<br />
schutzwürdigen Biotope mit den an sie gebundenen Papula·<br />
tionen liegen häufig inselartig in der intensiv bewirtschafte·<br />
ten und daher für viele Arten abweisend wirkenden Nutzlandschaft<br />
verstreut, was den lndividuenaustausch der Populationen<br />
erschwert. Dieser lndividuenaustausch ist aber<br />
nötig, um eine genetische Verarmung der Arten oder Inzucht<br />
zu vermeiden.<br />
Eine netzartige Verknüpfung von solchen Biotopen in Form<br />
eines Biotopverbundsystems ist vorrangiges Ziel des Biotop·<br />
und <strong>Artenschutz</strong>es. Daher wird in Nordrhein- Westfalen<br />
angestrebt, die Naturschutzgebiete in „Schutzgebietsyste·<br />
men" großräumig aufeinander zu beziehen und in „Biotop·<br />
verbundsystemen " kleinräumig miteinander zu verbinden<br />
oder zu verzahnen (vgl. Abb.)5l.<br />
;-otopverbund:--;r.i t ~<br />
Abb. 1: Hierarchische Ordnung groß· und kleinrä.umiger Schutz.gebietssysteme (gepunktete<br />
Linien = beliebige Distanzen, gestrichelte Linien = kritische Distanzen bzw. Minimaldistan·<br />
zen, durchgezogene LJnien = durchgehende Verbindungen)<br />
5) Aus: SCHMIDT, Albert, 1984, Biotopschutzprogramm<br />
Nordrhein-Westfalen. Vom isolierten Schutzgebiet zum<br />
Biotopverbundsystem, Teil 1 u. 2, Mitteilungen der<br />
Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung<br />
und Forstplanung, 9, H. 1 u. 2.<br />
544