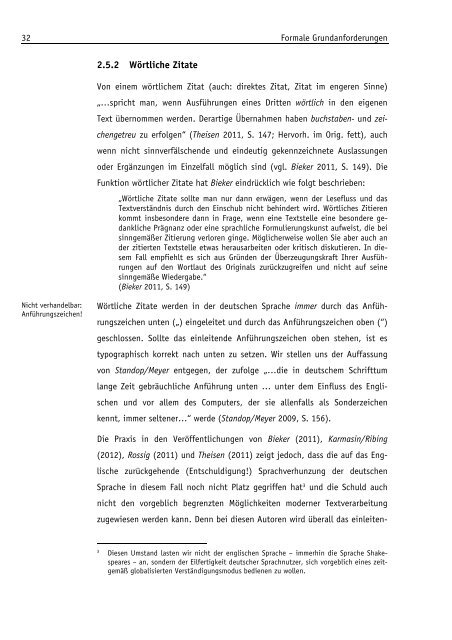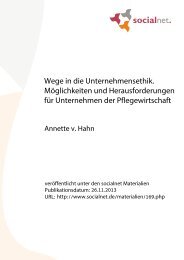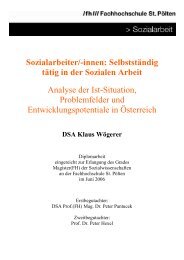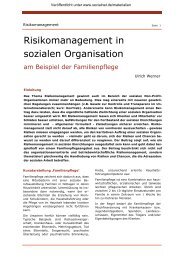Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
32 Formale Grundanforderungen<br />
2.5.2 Wörtliche Zitate<br />
Von einem wörtlichem Zitat (auch: direktes Zitat, Zitat im engeren Sinne)<br />
„…spricht man, wenn Ausführungen eines Dritten wörtlich in den eigenen<br />
Text übernommen werden. Derartige Übernahmen haben buchstaben- und zeichengetreu<br />
zu erfolgen“ (Theisen 2011, S. 147; Hervorh. im Orig. fett), auch<br />
wenn nicht sinnverfälschende und eindeutig gekennzeichnete Auslassungen<br />
oder Ergänzungen im Einzelfall möglich sind (vgl. Bieker 2011, S. 149). Die<br />
Funktion wörtlicher Zitate hat Bieker eindrücklich wie folgt beschrieben:<br />
„Wörtliche Zitate sollte man nur dann erwägen, wenn der Lesefluss und das<br />
Textverständnis durch den Einschub nicht behindert wird. Wörtliches Zitieren<br />
kommt insbesondere dann in Frage, wenn eine Textstelle eine besondere gedankliche<br />
Prägnanz oder eine sprachliche Formulierungskunst aufweist, die bei<br />
sinngemäßer Zitierung verloren ginge. Möglicherweise wollen Sie aber auch an<br />
der zitierten Textstelle etwas herausarbeiten oder kritisch diskutieren. In diesem<br />
Fall empfiehlt es sich aus Gründen der Überzeugungskraft Ihrer Ausführungen<br />
auf den Wortlaut des Originals zurückzugreifen und nicht auf seine<br />
sinngemäße Wiedergabe.“<br />
(Bieker 2011, S. 149)<br />
Nicht verhandelbar:<br />
Anführungszeichen!<br />
Wörtliche Zitate werden in der deutschen Sprache immer durch das Anführungszeichen<br />
unten („) eingeleitet und durch das Anführungszeichen oben (“)<br />
geschlossen. Sollte das einleitende Anführungszeichen oben stehen, ist es<br />
typographisch korrekt nach unten zu setzen. Wir stellen uns der Auffassung<br />
von Standop/Meyer entgegen, der zufolge „…die in deutschem Schrifttum<br />
lange Zeit gebräuchliche Anführung unten … unter dem Einfluss des Englischen<br />
und vor allem des Computers, der sie allenfalls als Sonderzeichen<br />
kennt, immer seltener…“ werde (Standop/Meyer 2009, S. 156).<br />
Die Praxis in den Veröffentlichungen von Bieker (2011), Karmasin/Ribing<br />
(2012), Rossig (2011) und Theisen (2011) zeigt jedoch, dass die auf das Englische<br />
zurückgehende (Entschuldigung!) Sprachverhunzung der deutschen<br />
Sprache in diesem Fall noch nicht Platz gegriffen hat 3 und die Schuld auch<br />
nicht den vorgeblich begrenzten Möglichkeiten moderner Textverarbeitung<br />
zugewiesen werden kann. Denn bei diesen Autoren wird überall das einleiten-<br />
3<br />
Diesen Umstand lasten wir nicht der englischen Sprache – immerhin die Sprache Shakespeares<br />
– an, sondern der Eilfertigkeit deutscher Sprachnutzer, sich vorgeblich eines zeitgemäß<br />
globalisierten Verständigungsmodus bedienen zu wollen.