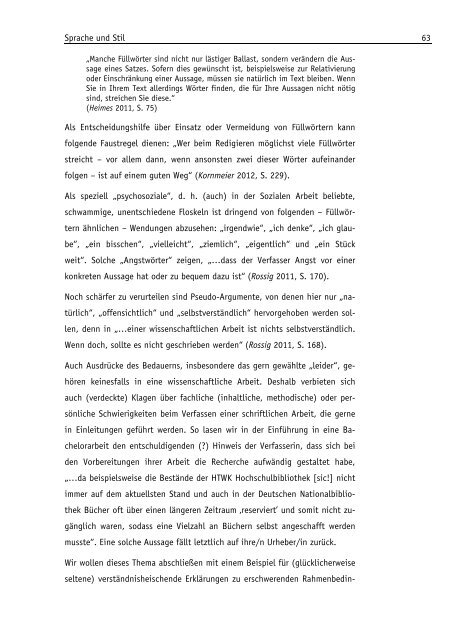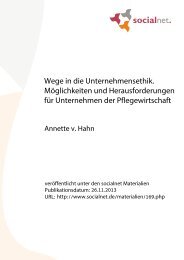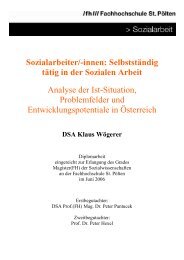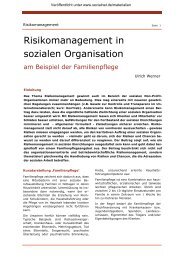Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sprache und Stil 63<br />
„Manche Füllwörter sind nicht nur lästiger Ballast, sondern verändern die Aussage<br />
eines Satzes. Sofern dies gewünscht ist, beispielsweise zur Relativierung<br />
oder Einschränkung einer Aussage, müssen sie natürlich im Text bleiben. Wenn<br />
Sie in Ihrem Text allerdings Wörter finden, die für Ihre Aussagen nicht nötig<br />
sind, streichen Sie diese.“<br />
(Heimes 2011, S. 75)<br />
Als Entscheidungshilfe über Einsatz oder Vermeidung von Füllwörtern kann<br />
folgende Faustregel dienen: „Wer beim Redigieren möglichst viele Füllwörter<br />
streicht – vor allem dann, wenn ansonsten zwei dieser Wörter aufeinander<br />
folgen – ist auf einem guten Weg“ (Kornmeier 2012, S. 229).<br />
Als speziell „psychosoziale“, d. h. (auch) in der Sozialen Arbeit beliebte,<br />
schwammige, unentschiedene Floskeln ist dringend von folgenden – Füllwörtern<br />
ähnlichen – Wendungen abzusehen: „irgendwie“, „ich denke“, „ich glaube“,<br />
„ein bisschen“, „vielleicht“, „ziemlich“, „eigentlich“ und „ein Stück<br />
weit“. Solche „Angstwörter“ zeigen, „…dass der Verfasser Angst vor einer<br />
konkreten Aussage hat oder zu bequem dazu ist“ (Rossig 2011, S. 170).<br />
Noch schärfer zu verurteilen sind Pseudo-Argumente, von denen hier nur „natürlich“,<br />
„offensichtlich“ und „selbstverständlich“ hervorgehoben werden sollen,<br />
denn in „…einer wissenschaftlichen Arbeit ist nichts selbstverständlich.<br />
Wenn doch, sollte es nicht geschrieben werden“ (Rossig 2011, S. 168).<br />
Auch Ausdrücke des Bedauerns, insbesondere das gern gewählte „leider“, gehören<br />
keinesfalls in eine wissenschaftliche Arbeit. Deshalb verbieten sich<br />
auch (verdeckte) Klagen über fachliche (inhaltliche, methodische) oder persönliche<br />
Schwierigkeiten beim Verfassen einer schriftlichen Arbeit, die gerne<br />
in Einleitungen geführt werden. So lasen wir in der Einführung in eine Bachelorarbeit<br />
den entschuldigenden (?) Hinweis der Verfasserin, dass sich bei<br />
den Vorbereitungen ihrer Arbeit die Recherche aufwändig gestaltet habe,<br />
„…da beispielsweise die Bestände der HTWK Hochschulbibliothek [sic!] nicht<br />
immer auf dem aktuellsten Stand und auch in der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Bücher oft über einen längeren Zeitraum ‚reserviert’ und somit nicht zugänglich<br />
waren, sodass eine Vielzahl an Büchern selbst angeschafft werden<br />
musste“. Eine solche Aussage fällt letztlich auf ihre/n Urheber/in zurück.<br />
Wir wollen dieses Thema abschließen mit einem Beispiel für (glücklicherweise<br />
seltene) verständnisheischende Erklärungen zu erschwerenden Rahmenbedin-