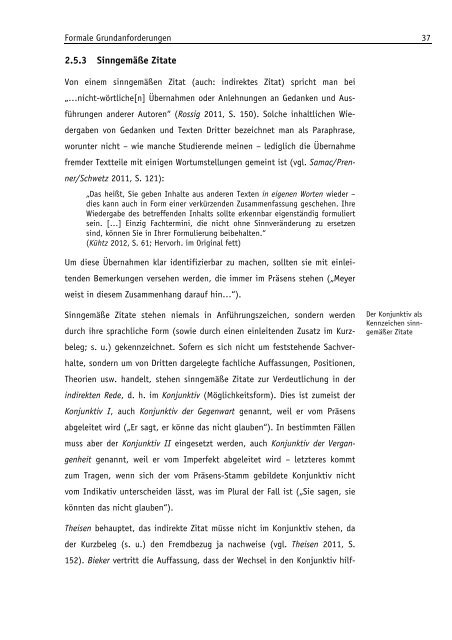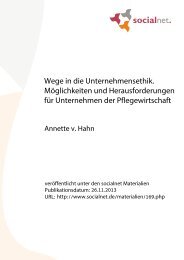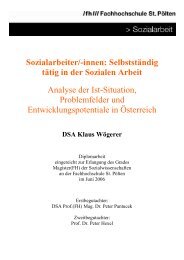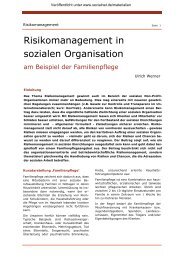Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Formale Grundanforderungen 37<br />
2.5.3 Sinngemäße Zitate<br />
Von einem sinngemäßen Zitat (auch: indirektes Zitat) spricht man bei<br />
„…nicht-wörtliche[n] Übernahmen oder Anlehnungen an Gedanken und Ausführungen<br />
anderer Autoren“ (Rossig 2011, S. 150). Solche inhaltlichen Wiedergaben<br />
von Gedanken und Texten Dritter bezeichnet man als Paraphrase,<br />
worunter nicht – wie manche Studierende meinen – lediglich die Übernahme<br />
fremder Textteile mit einigen Wortumstellungen gemeint ist (vgl. Samac/Prenner/Schwetz<br />
2011, S. 121):<br />
„Das heißt, Sie geben Inhalte aus anderen Texten in eigenen Worten wieder –<br />
dies kann auch in Form einer verkürzenden Zusammenfassung geschehen. Ihre<br />
Wiedergabe des betreffenden Inhalts sollte erkennbar eigenständig formuliert<br />
sein. […] Einzig Fachtermini, die nicht ohne Sinnveränderung zu ersetzen<br />
sind, können Sie in Ihrer Formulierung beibehalten.“<br />
(Kühtz 2012, S. 61; Hervorh. im Original fett)<br />
Um diese Übernahmen klar identifizierbar zu machen, sollten sie mit einleitenden<br />
Bemerkungen versehen werden, die immer im Präsens stehen („Meyer<br />
weist in diesem Zusammenhang darauf hin…“).<br />
Sinngemäße Zitate stehen niemals in Anführungszeichen, sondern werden<br />
durch ihre sprachliche Form (sowie durch einen einleitenden Zusatz im Kurzbeleg;<br />
s. u.) gekennzeichnet. Sofern es sich nicht um feststehende Sachverhalte,<br />
sondern um von Dritten dargelegte fachliche Auffassungen, Positionen,<br />
Theorien usw. handelt, stehen sinngemäße Zitate zur Verdeutlichung in der<br />
indirekten Rede, d. h. im Konjunktiv (Möglichkeitsform). Dies ist zumeist der<br />
Konjunktiv I, auch Konjunktiv der Gegenwart genannt, weil er vom Präsens<br />
abgeleitet wird („Er sagt, er könne das nicht glauben“). In bestimmten Fällen<br />
muss aber der Konjunktiv II eingesetzt werden, auch Konjunktiv der Vergangenheit<br />
genannt, weil er vom Imperfekt abgeleitet wird – letzteres kommt<br />
zum Tragen, wenn sich der vom Präsens-Stamm gebildete Konjunktiv nicht<br />
vom Indikativ unterscheiden lässt, was im Plural der Fall ist („Sie sagen, sie<br />
könnten das nicht glauben“).<br />
Der Konjunktiv als<br />
Kennzeichen sinngemäßer<br />
Zitate<br />
Theisen behauptet, das indirekte Zitat müsse nicht im Konjunktiv stehen, da<br />
der Kurzbeleg (s. u.) den Fremdbezug ja nachweise (vgl. Theisen 2011, S.<br />
152). Bieker vertritt die Auffassung, dass der Wechsel in den Konjunktiv hilf-