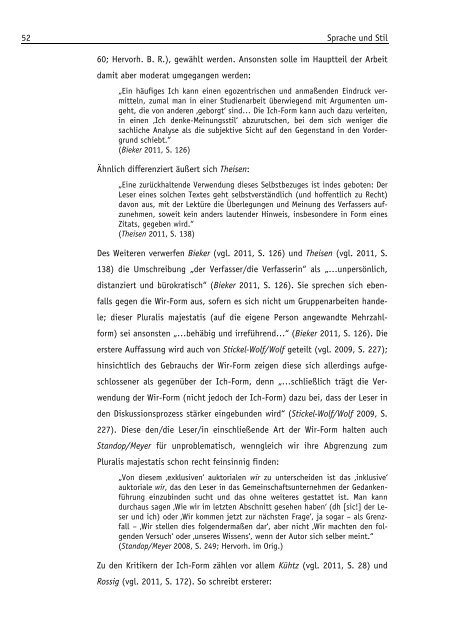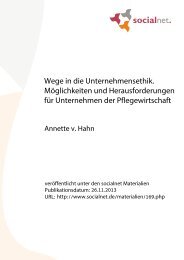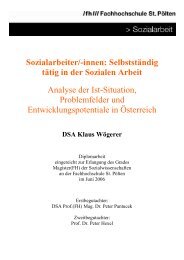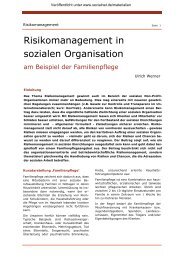Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52 Sprache und Stil<br />
60; Hervorh. B. R.), gewählt werden. Ansonsten solle im Hauptteil der Arbeit<br />
damit aber moderat umgegangen werden:<br />
„Ein häufiges Ich kann einen egozentrischen und anmaßenden Eindruck vermitteln,<br />
zumal man in einer Studienarbeit überwiegend mit Argumenten umgeht,<br />
die von anderen ‚geborgt‘ sind… Die Ich-Form kann auch dazu verleiten,<br />
in einen ‚Ich denke-Meinungsstil‘ abzurutschen, bei dem sich weniger die<br />
sachliche Analyse als die subjektive Sicht auf den Gegenstand in den Vordergrund<br />
schiebt.“<br />
(Bieker 2011, S. 126)<br />
Ähnlich differenziert äußert sich Theisen:<br />
„Eine zurückhaltende Verwendung dieses Selbstbezuges ist indes geboten: Der<br />
Leser eines solchen Textes geht selbstverständlich (und hoffentlich zu Recht)<br />
davon aus, mit der Lektüre die Überlegungen und Meinung des Verfassers aufzunehmen,<br />
soweit kein anders lautender Hinweis, insbesondere in Form eines<br />
Zitats, gegeben wird.“<br />
(Theisen 2011, S. 138)<br />
Des Weiteren verwerfen Bieker (vgl. 2011, S. 126) und Theisen (vgl. 2011, S.<br />
138) die Umschreibung „der Verfasser/die Verfasserin“ als „…unpersönlich,<br />
distanziert und bürokratisch“ (Bieker 2011, S. 126). Sie sprechen sich ebenfalls<br />
gegen die Wir-Form aus, sofern es sich nicht um Gruppenarbeiten handele;<br />
dieser Pluralis majestatis (auf die eigene Person angewandte Mehrzahlform)<br />
sei ansonsten „…behäbig und irreführend…“ (Bieker 2011, S. 126). Die<br />
erstere Auffassung wird auch von Stickel-Wolf/Wolf geteilt (vgl. 2009, S. 227);<br />
hinsichtlich des Gebrauchs der Wir-Form zeigen diese sich allerdings aufgeschlossener<br />
als gegenüber der Ich-Form, denn „…schließlich trägt die Verwendung<br />
der Wir-Form (nicht jedoch der Ich-Form) dazu bei, dass der Leser in<br />
den Diskussionsprozess stärker eingebunden wird“ (Stickel-Wolf/Wolf 2009, S.<br />
227). Diese den/die Leser/in einschließende Art der Wir-Form halten auch<br />
Standop/Meyer für unproblematisch, wenngleich wir ihre Abgrenzung zum<br />
Pluralis majestatis schon recht feinsinnig finden:<br />
„Von diesem ‚exklusiven‘ auktorialen wir zu unterscheiden ist das ‚inklusive‘<br />
auktoriale wir, das den Leser in das Gemeinschaftsunternehmen der Gedankenführung<br />
einzubinden sucht und das ohne weiteres gestattet ist. Man kann<br />
durchaus sagen ‚Wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben‘ (dh [sic!] der Leser<br />
und ich) oder ‚Wir kommen jetzt zur nächsten Frage‘, ja sogar – als Grenzfall<br />
– ‚Wir stellen dies folgendermaßen dar‘, aber nicht ‚Wir machten den folgenden<br />
Versuch‘ oder ‚unseres Wissens‘, wenn der Autor sich selber meint.“<br />
(Standop/Meyer 2008, S. 249; Hervorh. im Orig.)<br />
Zu den Kritikern der Ich-Form zählen vor allem Kühtz (vgl. 2011, S. 28) und<br />
Rossig (vgl. 2011, S. 172). So schreibt ersterer: