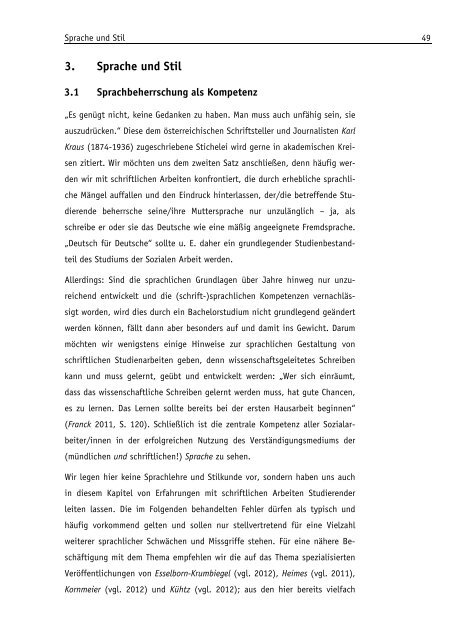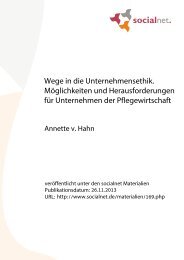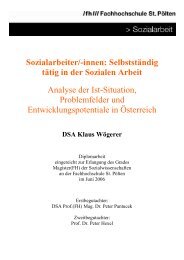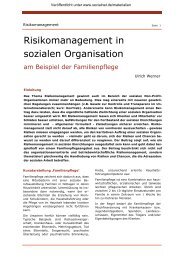Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sprache und Stil 49<br />
3. Sprache und Stil<br />
3.1 Sprachbeherrschung als Kompetenz<br />
„Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie<br />
auszudrücken.“ Diese dem österreichischen Schriftsteller und Journalisten Karl<br />
Kraus (1874-1936) zugeschriebene Stichelei wird gerne in akademischen Kreisen<br />
zitiert. Wir möchten uns dem zweiten Satz anschließen, denn häufig werden<br />
wir mit schriftlichen <strong>Arbeiten</strong> konfrontiert, die durch erhebliche sprachliche<br />
Mängel auffallen und den Eindruck hinterlassen, der/die betreffende Studierende<br />
beherrsche seine/ihre Muttersprache nur unzulänglich – ja, als<br />
schreibe er oder sie das Deutsche wie eine mäßig angeeignete Fremdsprache.<br />
„Deutsch für Deutsche“ sollte u. E. daher ein grundlegender Studienbestandteil<br />
des Studiums der Sozialen Arbeit werden.<br />
Allerdings: Sind die sprachlichen Grundlagen über Jahre hinweg nur unzureichend<br />
entwickelt und die (schrift-)sprachlichen Kompetenzen vernachlässigt<br />
worden, wird dies durch ein Bachelorstudium nicht grundlegend geändert<br />
werden können, fällt dann aber besonders auf und damit ins Gewicht. Darum<br />
möchten wir wenigstens einige Hinweise zur sprachlichen Gestaltung von<br />
schriftlichen Studienarbeiten geben, denn wissenschaftsgeleitetes Schreiben<br />
kann und muss gelernt, geübt und entwickelt werden: „Wer sich einräumt,<br />
dass das wissenschaftliche Schreiben gelernt werden muss, hat gute Chancen,<br />
es zu lernen. Das Lernen sollte bereits bei der ersten Hausarbeit beginnen“<br />
(Franck 2011, S. 120). Schließlich ist die zentrale Kompetenz aller Sozialarbeiter/innen<br />
in der erfolgreichen Nutzung des Verständigungsmediums der<br />
(mündlichen und schriftlichen!) Sprache zu sehen.<br />
Wir legen hier keine Sprachlehre und Stilkunde vor, sondern haben uns auch<br />
in diesem Kapitel von Erfahrungen mit schriftlichen <strong>Arbeiten</strong> Studierender<br />
leiten lassen. Die im Folgenden behandelten Fehler dürfen als typisch und<br />
häufig vorkommend gelten und sollen nur stellvertretend für eine Vielzahl<br />
weiterer sprachlicher Schwächen und Missgriffe stehen. Für eine nähere Beschäftigung<br />
mit dem Thema empfehlen wir die auf das Thema spezialisierten<br />
Veröffentlichungen von Esselborn-Krumbiegel (vgl. 2012), Heimes (vgl. 2011),<br />
Kornmeier (vgl. 2012) und Kühtz (vgl. 2012); aus den hier bereits vielfach