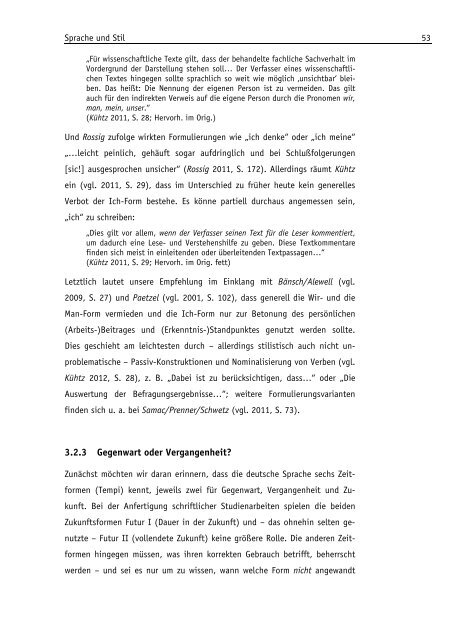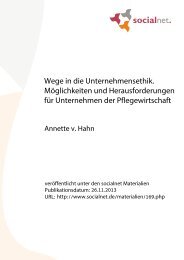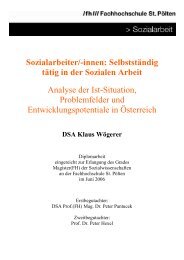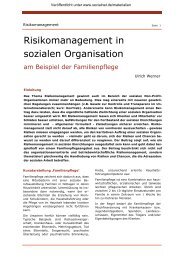Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Wissenschaftliches Arbeiten - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sprache und Stil 53<br />
„Für wissenschaftliche Texte gilt, dass der behandelte fachliche Sachverhalt im<br />
Vordergrund der Darstellung stehen soll… Der Verfasser eines wissenschaftlichen<br />
Textes hingegen sollte sprachlich so weit wie möglich ‚unsichtbar‘ bleiben.<br />
Das heißt: Die Nennung der eigenen Person ist zu vermeiden. Das gilt<br />
auch für den indirekten Verweis auf die eigene Person durch die Pronomen wir,<br />
man, mein, unser.“<br />
(Kühtz 2011, S. 28; Hervorh. im Orig.)<br />
Und Rossig zufolge wirkten Formulierungen wie „ich denke“ oder „ich meine“<br />
„…leicht peinlich, gehäuft sogar aufdringlich und bei Schlußfolgerungen<br />
[sic!] ausgesprochen unsicher“ (Rossig 2011, S. 172). Allerdings räumt Kühtz<br />
ein (vgl. 2011, S. 29), dass im Unterschied zu früher heute kein generelles<br />
Verbot der Ich-Form bestehe. Es könne partiell durchaus angemessen sein,<br />
„ich“ zu schreiben:<br />
„Dies gilt vor allem, wenn der Verfasser seinen Text für die Leser kommentiert,<br />
um dadurch eine Lese- und Verstehenshilfe zu geben. Diese Textkommentare<br />
finden sich meist in einleitenden oder überleitenden Textpassagen…“<br />
(Kühtz 2011, S. 29; Hervorh. im Orig. fett)<br />
Letztlich lautet unsere Empfehlung im Einklang mit Bänsch/Alewell (vgl.<br />
2009, S. 27) und Paetzel (vgl. 2001, S. 102), dass generell die Wir- und die<br />
Man-Form vermieden und die Ich-Form nur zur Betonung des persönlichen<br />
(Arbeits-)Beitrages und (Erkenntnis-)Standpunktes genutzt werden sollte.<br />
Dies geschieht am leichtesten durch – allerdings stilistisch auch nicht unproblematische<br />
– Passiv-Konstruktionen und Nominalisierung von Verben (vgl.<br />
Kühtz 2012, S. 28), z. B. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass…“ oder „Die<br />
Auswertung der Befragungsergebnisse…“; weitere Formulierungsvarianten<br />
finden sich u. a. bei Samac/Prenner/Schwetz (vgl. 2011, S. 73).<br />
3.2.3 Gegenwart oder Vergangenheit?<br />
Zunächst möchten wir daran erinnern, dass die deutsche Sprache sechs Zeitformen<br />
(Tempi) kennt, jeweils zwei für Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.<br />
Bei der Anfertigung schriftlicher Studienarbeiten spielen die beiden<br />
Zukunftsformen Futur I (Dauer in der Zukunft) und – das ohnehin selten genutzte<br />
– Futur II (vollendete Zukunft) keine größere Rolle. Die anderen Zeitformen<br />
hingegen müssen, was ihren korrekten Gebrauch betrifft, beherrscht<br />
werden – und sei es nur um zu wissen, wann welche Form nicht angewandt