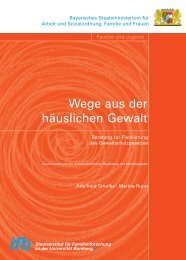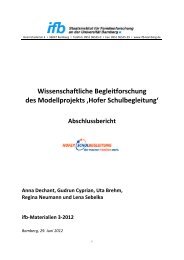ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Die Arbeit von Covell & Turnbull (1982; nach Erhard/Janig 2003: 147) zählt zu den wenigen Studien,<br />
in denen verschiedene Formen <strong>der</strong> Vaterabwesenheit in ihren Auswirkungen auf die Partnerschaftsentwicklung<br />
junger Erwachsener – es handelt sich ausschließlich um männliche Studierende<br />
– verglichen werden. Dabei zeigt sich, dass junge Männer, die bei geschiedenen allein<br />
erziehenden Müttern aufwuchsen, seltener enge Partnerschaften eingehen bzw. mit einer Partnerin<br />
zusammenziehen als Studenten, die bei zusammen lebenden Eltern lebten. Bei Studenten,<br />
die als Halbwaisen von ihren Müttern erzogen wurden, sind entsprechende Unterschiede nicht<br />
feststellbar. Dies spricht dafür, dass die verzögerte Partnerschaftsentwicklung weniger auf Vaterabwesenheit<br />
als auf scheidungsspezifische Faktoren, wie z. B. ein erhöhtes Ausmaß von Konflikten<br />
zwischen den Eltern, zurückzuführen ist.<br />
Frauen, die eine Trennung <strong>der</strong> Eltern erlebt haben, lösen sich früher von <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> ab, gehen<br />
früher sexuelle Beziehungen ein und vollziehen früher den Übergang zur Erstelternschaft (zusfd.<br />
s. Dunn 2004). Entsprechende Befunde liegen auch für junge Männer vor, die bei geschiedenen<br />
allein erziehenden Teenagermüttern aufwuchsen (Furstenberg/Weiss 2000).<br />
Die Bedeutung einer weiteren männlichen Bezugsperson für das Kind<br />
In seiner Zusammenstellung <strong>der</strong> Befundlage bis Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre kommt Fthenakis zur<br />
Einschätzung, dass männliche Bezugspersonen, wie z. B. ein Stiefvater, mögliche negative Auswirkungen<br />
<strong>der</strong> Abwesenheit des leiblichen Vaters kompensieren (Fthenakis 1988). Aktuelle<br />
Studien, die die Bedeutung eines Stiefvaters für Kin<strong>der</strong> aus Scheidungsfamilien untersuchen,<br />
kommen jedoch zu wi<strong>der</strong>sprüchlichen Ergebnissen. Dabei setzt sich auch hier eine stark differenzielle<br />
Perspektive durch: Mit einer an<strong>der</strong>en männlichen Bezugsperson sind nur unter bestimmten<br />
Voraussetzungen positive Folgen für die kindliche Entwicklung zu erwarten. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
Kin<strong>der</strong>, <strong>der</strong>en Beziehung zum getrennt lebenden Vater belastet ist, könnten profitieren<br />
(zusfd. Dunn/Cheng/O’Conner/Bridges 2004). Ausgehend von ihren eigenen Studien zeigt Flouri<br />
(2005) jedoch, dass Kin<strong>der</strong>, die ihre Beziehung zum getrennt lebenden Vater als schwierig einstufen,<br />
häufig auch eine problematische Beziehung zum Stiefvater haben. Bei diesen Kin<strong>der</strong>n<br />
zeigen sich erhöhte Entwicklungsrisiken.<br />
3.4.2 Entwicklungsför<strong>der</strong>nde Beiträge des getrennt lebenden Vaters<br />
Die Bedeutung des finanziellen Kapitals<br />
Unumstritten ist, dass die Entwicklung von Kin<strong>der</strong>n nach Trennung und Scheidung maßgeblich<br />
durch die finanzielle Situation <strong>der</strong> Alleinerziehendenfamilie beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang<br />
kommt den finanziellen Transferleistungen in Form von Unterhaltszahlungen<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en materiellen Zuwendungen, die getrennt lebende Väter ihrem Nachwuchs zur Verfügung<br />
stellen, eine zentrale Bedeutung zu. Kin<strong>der</strong>, die von ihren Vätern regelmäßig finanziell<br />
unterstützt werden, zeigen höhere Lese- und Mathematikleistungen, verbleiben länger im Bildungssystem<br />
und erreichen entsprechend höhere Bildungsabschlüsse (Amato & Gilbreth 1999).<br />
Zudem senken regelmäßige Transferleistungen <strong>der</strong> getrennt lebenden Väter das Ausmaß von<br />
Verhaltensproblemen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit des Kindes spielen<br />
dabei keine wesentliche Rolle. Die finanziellen Leistungen <strong>der</strong> getrennt lebenden Väter verbessern<br />
die Lebensbedingungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> – sie werden beispielsweise gesün<strong>der</strong> ernährt und erhalten<br />
mehr Anregungen im häuslichen Umfeld – dies erhöht ihre Bildungschancen (Amato &<br />
Sobolewski 2004). Daneben dürften die Unterschiede auch darauf zurückzuführen sein, dass regelmäßig<br />
erfolgende Unterhaltszahlungen zur Entlastung <strong>der</strong> allein erziehenden Mütter beitragen<br />
und dadurch <strong>der</strong>en elterliche Kompetenzen stärken (vgl. Limmer 2004).<br />
Wenn <strong>der</strong> Vater im Alltag fehlt<br />
99