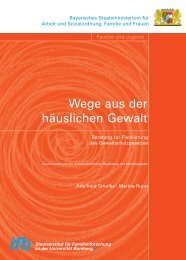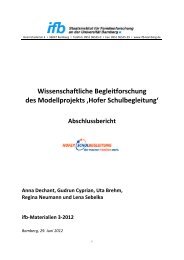ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Die räumliche Trennung vom Vater und <strong>der</strong> für einen großen Teil <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> damit einhergehende<br />
deutlich verringerte und verän<strong>der</strong>te Kontakt zum Vater gilt als <strong>der</strong> entscheidende Mechanismus,<br />
<strong>der</strong> zur Verschlechterung <strong>der</strong> Befindlichkeit beiträgt (Amato/Sobolewski 2004). Daneben<br />
spielen jedoch weitere Ursachen eine Rolle, wie u. a. ein anhaltend hohes elterliches<br />
Konfliktniveau, ein geringeres Ausmaß emotionaler Unterstützung, ökonomische Probleme <strong>der</strong><br />
<strong>Familie</strong> und weitere belastende Lebensereignisse, wie z. B. ein Umzug o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verlust von Beziehungen<br />
zur Herkunftsfamilie des Vaters (Amato 2000).<br />
Analog zu Studien mit jüngeren Kin<strong>der</strong>n erweist sich eine schwache Beziehung 70 zum getrennt<br />
lebenden Vater auch bei jungen Erwachsenen als maßgebliche Ursache <strong>der</strong> verringerten Befindlichkeit<br />
(Amato/Sobolweski 2001). Dabei wird davon ausgegangen, dass <strong>der</strong> Übergang ins<br />
Erwachsenenleben eine Phase erhöhter Instabilität darstellt, in <strong>der</strong> den Vätern sowohl durch die<br />
Bereitstellung von finanziellem als auch sozialem Kapital eine wichtige Funktion zukommt. Getrennt<br />
lebende Väter leisten weniger materielle, emotionale und praktische Unterstützung beim<br />
Übergang ins Berufsleben. Zudem ist auch <strong>der</strong> Zugang zu Ressourcen an<strong>der</strong>er Verwandter, wie<br />
z. B. zu den Großeltern, bei Kin<strong>der</strong>n aus Scheidungsfamilien vermin<strong>der</strong>t (Amato/Sobolweski<br />
2001, 2005).<br />
Sozioemotionale Entwicklung<br />
Ausgehend von bindungstheoretischen Annahmen haben Böhm/Grossmann (2000) sowie<br />
Böhm/Emslän<strong>der</strong> & Grossmann (2001) die sozioemotionale Entwicklung von 9- bis 14jährigen<br />
Jungen aus Scheidungsfamilien mit Buben, die bei zusammen lebenden Eltern aufwachsen,<br />
verglichen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Kin<strong>der</strong> geschiedener Eltern stärker<br />
belastet fühlen, ihre Belastungsgefühle weniger gut ausdrücken können und vermehrt nach Bestätigung<br />
durch das Umfeld suchen. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Trennungserfahrung<br />
zur Ausbildung eines unsicheren Bindungsstils beiträgt. Die Hinweise auf ein höheres Ausmaß<br />
von Belastungsgefühlen bei gleichzeitig verringerten Bewältigungskompetenzen werden<br />
auch von tiefenpsychologischen Arbeiten gestützt. So zeigen die Arbeiten von Figdor (1991,<br />
1997; nach Erhard/Janig 2003: S. 61), dass sich Kin<strong>der</strong>, denen <strong>der</strong> Kontakt zum getrennt lebenden<br />
Elternteil fehlt, häufig schuldig an den elterlichen Konflikten o<strong>der</strong> von den Eltern enttäuscht<br />
fühlen. Diese Gefühle tragen zu einem erhöhten Aggressionspotential bei. Trotz des methodisch<br />
anspruchsvollen Designs dieser Studien, haben die Ergebnisse bisher den Stellenwert vorläufiger<br />
Hinweise, da die Datenbasis aufgrund <strong>der</strong> geringen Stichprobengröße nur von eingeschränkter<br />
Aussagekraft ist.<br />
Auf einer breiten empirischen Basis bestätigt sich, dass Söhne, die getrennt vom Vater aufgewachsen<br />
sind, ein höheres Ausmaß an externalisierenden Verhaltensproblemen, wie z. B. aggressives<br />
Problemverhalten und Delinquenz, zeigen. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für Jungs, die bei<br />
allein erziehenden Müttern mit einem geringem sozioökonomischen Status aufwachsen o<strong>der</strong><br />
Peergroups angehören, in denen aggressives Verhalten positiv verstärkt wird (vgl. Erhard/Janig<br />
2003). Als mögliche Gründe hierfür werden das fehlende Rollenmodell des Vaters sowie die verän<strong>der</strong>te<br />
Mutter-Kind-Interaktion diskutiert.<br />
Wie bereits dargelegt, wird dem Vater eine hohe Bedeutung für die Autonomieentwicklung zugeschrieben.<br />
Walper (1998) untersucht in ihrer Studie den Prozess <strong>der</strong> Individuation von Jugendlichen<br />
aus <strong>Familie</strong>n mit zusammen lebenden und getrennt lebenden Eltern. Dabei können<br />
nur schwache Zusammenhänge zwischen <strong>der</strong> Individuation und <strong>der</strong> <strong>Familie</strong>nform festgestellt<br />
werden. Das geringfügig schlechtere Abschneiden <strong>der</strong> Jugendlichen aus Scheidungsfamilien<br />
steht mit dem Kontakt zum getrennt lebenden Vater in Verbindung: Jugendliche, die ihren ge-<br />
70 Die Qualität <strong>der</strong> Beziehung zum Vater wurde erfasst, indem danach gefragt wurde, ob die Kin<strong>der</strong> Vertrauen zum Vater haben, sich von ihm<br />
respektiert fühlen und ihm emotional nahe stehen.<br />
Wenn <strong>der</strong> Vater im Alltag fehlt<br />
97