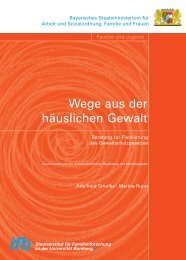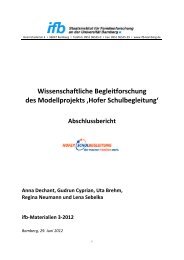ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wenn <strong>der</strong> Vater im Alltag fehlt<br />
90<br />
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
<strong>Zur</strong> Klärung <strong>der</strong> Frage nach den Folgen <strong>der</strong> Vaterabwesenheit für die Kin<strong>der</strong> ist es demnach erfor<strong>der</strong>lich,<br />
die unterschiedlichen Formen und das unterschiedliche Ausmaß des väterlichen Engagements<br />
zu berücksichtigen. Zudem müssen die Effekte in Bezug gesetzt werden zu den Beiträgen <strong>der</strong><br />
Mütter. Von einer entsprechend systematischen und annähernd umfassenden Bearbeitung <strong>der</strong><br />
Frage sind wir bislang noch weit entfernt. Doch liegen aus verschiedenen Forschungsbereichen Befunde<br />
vor, die Annäherungen erlauben: So gewähren Studien, die den Einfluss von Vätern in Kernfamilien<br />
auf die kindliche Entwicklung untersuchen, auch Hinweise auf die Bedeutung <strong>der</strong> Vaterabwesenheit.<br />
Die zahlreichsten und differenziertesten Anhaltspunkte werden jedoch im Kontext <strong>der</strong><br />
Scheidungsforschung vorgelegt. Den Ergebnissen dieser Arbeiten kommt daher im Folgenden beson<strong>der</strong>e<br />
Aufmerksamkeit zu. Bevor auf die aktuelle Forschungslage näher eingegangen wird, erfolgt<br />
zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick über die entwicklungspsychologische Vaterforschung.<br />
3.2 Historischer Abriss <strong>der</strong> entwicklungspsychologischen Vaterforschung<br />
Der historische Rückblick zeigt, dass dem Vater in Westeuropa seit jeher vielfältige Funktionen<br />
zugeschrieben werden, wobei je nach gesellschaftlichem Kontext unterschiedliche Aspekte im<br />
Vor<strong>der</strong>grund stehen. Lamb fasst den Entwicklungsverlauf wie folgt zusammen: „the dominant<br />
defining motif has shifted in succession from an emphasis on moral guidance, to a focus on breadwinning,<br />
then to sex-role modelling, marital-support, and finally, nurturance“ (Lamb 2000: 24). Bis<br />
in das 20. Jahrhun<strong>der</strong>t wurde Vätern im Leben ihrer Kin<strong>der</strong> primär die Funktion <strong>der</strong> moralischen<br />
Autorität und des Ernährers zugeschrieben. Als Interaktionspartner <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, <strong>der</strong> im Alltag als<br />
Rollenmodell dient o<strong>der</strong> pflegerische Aufgaben übernimmt, dürften Väter weitaus seltener als<br />
heute in Erscheinung getreten sein (Gestrich/Krause/Mitterauer 2003). Eine empirisch fundierte<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Frage nach <strong>der</strong> Bedeutung des Vaters für die kindliche Entwicklung<br />
beginnt im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t und kann in folgende Phasen unterteilt werden:<br />
• Der Vater als unerlässliches Korrektiv zum mütterlichen Einfluss<br />
Zu Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts stand fraglos die Bedeutung die Rolle des Vaters als Ernährer<br />
und moralische Autorität im Vor<strong>der</strong>grund. Mit <strong>der</strong> Beschreibung <strong>der</strong> psychosexuellen Entwicklung<br />
des Kindes konzipierte Freud eine Theorie, die die Funktion des Vaters als Interaktionspartner<br />
für das Kind erstmals differenzierter ausarbeitet. Zwar geht Freud davon aus,<br />
dass die Mutter in den ersten Lebensjahren des Kindes, die entscheidende Bezugsperson ist,<br />
<strong>der</strong> die Pflege und Betreuung obliegt. Doch mit zunehmendem Alter des Kindes schreibt er<br />
dem Vater die Aufgabe zu, die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind aufzubrechen,<br />
das Kind mit den Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Umwelt zu konfrontieren und in die Gesellschaft<br />
einzuführen (vgl. Köhler 1990). Ein entsprechendes Vaterverhalten ist aus <strong>der</strong> Sicht von Freud<br />
und seinen Nachfolgern für die Entwicklung von Autonomie, eines stabilen Selbstwertgefühls<br />
und gefestigter Geschlechtsrollenidentität entscheidend. Die Abwesenheit des Vaters,<br />
so die These, schadet insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Entwicklung von Söhnen nachhaltig. Ausgehend von<br />
psychoanalytischen Theorien gingen einige Forscher in den 1960er Jahren davon aus, dass<br />
Mütter einen krankmachenden Einfluss auf die Kin<strong>der</strong> ausübten („pathology of matriarchy“,<br />
Silverstein/Auerbach 1999). Für eine gelingende Entwicklung wurde die Anwesenheit des<br />
Vaters im Leben <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> als unerlässlich angesehen. Letztlich trugen diese Annahmen<br />
maßgeblich dazu bei, dass bis in die 1970er Jahre hinein allein erziehende Frauen als unzureichende<br />
Mütter wahrgenommen wurden (Schnei<strong>der</strong>/Rosenkranz/Limmer 1998).<br />
In den konkreten empirischen Arbeiten stand weniger die Bedeutung des anwesenden Vaters<br />
im Mittelpunkt als die Auswirkungen <strong>der</strong> Abwesenheit von Vätern. Dabei handelte es sich bis<br />
zum Ende <strong>der</strong> 1950er Jahre in aller Regel um Väter, die kriegsbedingt abwesend waren.