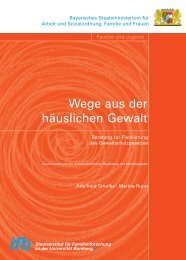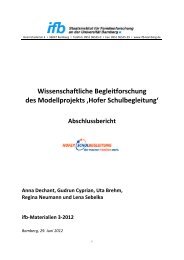ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Väter im internationalen Vergleich<br />
120<br />
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Ressourcen für familiäres Engagement zur Verfügung haben. Mehrere Studien haben schließlich<br />
auf die Bedeutung konfessioneller Zugehörigkeit bzw. Religiosität hingewiesen (Kurz 1998:<br />
176f., Hofäcker & Lück 2004). Demzufolge neigen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> katholischen Kirche sowie<br />
„praktizierende“ Mitglie<strong>der</strong> christlicher Kirchen allgemein eher zu traditionellen Einstellungen<br />
bezüglich familialer Arbeitsteilung.<br />
4.3 Väter im internationalen Vergleich – ein empirischer Überblick<br />
Der vorangegangene Abschnitt skizzierte die nationalen und individuellen Kontextbedingungen<br />
für „neue Väter“ in Europa. Im Folgenden soll nun anhand von aktuellen Umfrage- und Zeitbudgetdaten<br />
ein empirischer Überblick über die tatsächlichen Entwicklungsmuster neuer Väter aus<br />
dreifacher Perspektive gegeben werden: In einem ersten Schritt sollen zunächst die Einstellungsmuster<br />
von Vätern zu Fragen <strong>der</strong> innerfamilialen Arbeitsteilung und <strong>der</strong>en Entwicklung<br />
international vergleichend rekonstruiert werden. Die hier herauszuarbeitenden Trends werden<br />
anschließend den tatsächlichen Verhaltensmustern von Vätern in <strong>Familie</strong> und Erwerbsleben kritisch<br />
gegenübergestellt: In welchem zeitlichen Umfang engagieren sich europäische Väter in Erwerbsleben<br />
und <strong>Familie</strong>? Welche familiären Aufgaben übernehmen sie? Und welche Gruppen<br />
von Vätern tendieren am ehesten in Richtung eines „neuen Vatermodells“?<br />
Die folgenden empirischen Analysen stützen sich primär auf Eigenauswertungen des „International<br />
Social Survey Program (ISSP)“, eines international vergleichenden Umfrageprogramms,<br />
das seit 1983 jährlich in bis zu 40 verschiedenen Län<strong>der</strong>n durchgeführt wird. Jede Jahresumfrage<br />
ist mit einem spezifischen thematischen Schwerpunkt verbunden, <strong>der</strong> einen eigenen Fragenkomplex<br />
umfasst und in bestimmten Zeitabständen wie<strong>der</strong>holt erhoben wird. 1988, 1994<br />
und 2002 beschäftigte sich dieser Fragenkomplex mit dem Themenschwerpunkt „<strong>Familie</strong> und<br />
<strong>der</strong> Wandel <strong>der</strong> Geschlechterrollen“ und umfasste sowohl Fragen zu allgemeinen geschlechtsspezifischen<br />
Rollenmustern als auch zu konkreter familiärer Aufgabenteilung, auf die im Folgenden<br />
zurückgegriffen werden soll 85 . Da im Rahmen <strong>der</strong> ISSP-Umfragen die innerfamiliale Arbeitsteilung<br />
nur in Form einer Gesamtzeitschätzung bzw. einer kategorialen Abfrage erhoben wurde,<br />
werden zur detaillierteren Analyse außerdem ergänzend Ergebnisse des Harmonized European<br />
Time Use Survey [HETUS] (Eurostat 2004b) bzw. des „Network on Policies and the Division of<br />
Unpaid and Paid Work“ (Willemsen 2003) verwendet. Der Rückgriff auf sekundär erhobene<br />
Daten bringt dabei einige Einschränkungen mit sich: Zum einen kann <strong>der</strong> Begriff des „Vaters“<br />
nur in begrenzter Schärfe operationalisiert werden. Während die ISSP-Daten 1988 und 2002 Angaben<br />
zu Haushaltsgemeinschaft, Ehestand und Kin<strong>der</strong>zahl enthalten, wurde 1994 das Vorhandensein<br />
und die Anzahl von Kin<strong>der</strong>n im Haushalt nicht einheitlich erhoben. Um dennoch Vergleiche<br />
im Zeitverlauf vornehmen zu können, werden sowohl Ergebnisse für Väter mit Kin<strong>der</strong>n 86<br />
als auch für in Partnerschaft lebende Männer berichtet 87 . Schließlich verhin<strong>der</strong>t die im ISSP vorgenommene<br />
Befragung unterschiedlicher Personen zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten<br />
eine Untersuchung <strong>der</strong> individuellen Verläufe von Einstellungs- und Verhaltensmustern, die Ergebnisse<br />
können daher nur als gesamtgesellschaftlich aggregierte Trends interpretiert werden.<br />
85 Für einen umfassenden Überblick vgl. ZA 1998, 1994, 2002.<br />
86 Väter werden definiert als verheiratete o<strong>der</strong> mit festem Partner zusammen lebende Männer mit min<strong>der</strong>jährigen Kin<strong>der</strong>n im Haushalt (Jahre 1988<br />
und 2002), in Partnerschaft lebende Männer als verheiratete o<strong>der</strong> mit festem Partner lebende Männer, unabhängig von <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>zahl (Jahre 1988,<br />
1994, 2002), jeweils im Alter von 18-55 Jahren. Bei <strong>der</strong> Angabe <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>zahl im Haushalt ist für eine Vielzahl von Län<strong>der</strong>n nicht zu klären, ob es<br />
sich hier um eigene Kin<strong>der</strong> des befragten Vaters handelt. Die Daten von in Partnerschaft lebenden Männern mit Kin<strong>der</strong>n im Haushalt werden<br />
daher im Folgenden als Approximation für Väter angesehen.<br />
87 Bei <strong>der</strong> Analyse sozialstruktureller Subgruppen (ISSP 2002) wird aus Fallzahlgründen auf die Daten für Ehemänner ohne Berücksichtigung des<br />
Vorhandenseins von Kin<strong>der</strong>n zurückgegriffen; die Daten für Väter mit Kin<strong>der</strong>n werden als spezielle Subgruppe ausgewiesen.