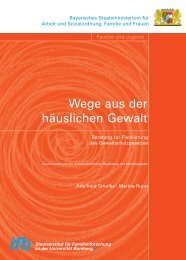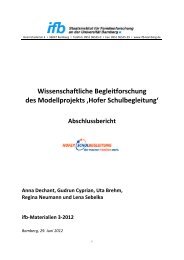ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
4. Väter im internationalen Vergleich (Dirk Hofäcker) 74<br />
4.1 Einleitung: „Neue Väter“ in Europa?<br />
4 Väter im internationalen Vergleich<br />
In Bezug auf die Entwicklung familialer Lebensformen hat sich in Europa in den vergangenen<br />
Jahrzehnten ein tiefgreifen<strong>der</strong> Wandel vollzogen: Bis Mitte des vergangenen Jahrhun<strong>der</strong>ts existierte<br />
in vielen europäischen <strong>Familie</strong>n mit Kin<strong>der</strong>n noch eine eindeutige Trennung zwischen<br />
einem erwerbstätigen, männlichen „<strong>Familie</strong>nernährer“ und einer auf Kin<strong>der</strong>erziehung und<br />
Hausarbeit fokussierten Ehefrau. Seit den 50er Jahren nehmen jedoch verheiratete Frauen und<br />
Mütter zunehmend am Erwerbsleben teil. International vergleichende Daten belegen in nahezu<br />
allen europäischen Staaten im Zeitverlauf eine Annäherung <strong>der</strong> Erwerbsteilnahme von Männern<br />
und Frauen (Hofäcker 2006, Mayer 1997) in Richtung einer Aufweichung des klassischen<br />
„Ernährermodells“, d. h. einer Erwerbstätigkeit bei<strong>der</strong> Ehepartner (Lewis 2004). Eine große Anzahl<br />
oft auch international-vergleichen<strong>der</strong> Publikationen analysierte in den vergangenen Jahrzehnten<br />
die Auswirkungen dieses Wandlungsprozesses, zumeist mit Fokus auf <strong>der</strong> gewandelten<br />
Rolle von Müttern, ihren Tätigkeiten und ihrer Zeitverwendung im Spannungsfeld von <strong>Familie</strong><br />
und Beruf. Sie betonten in diesem Zusammenhang insbeson<strong>der</strong>e die Auswirkungen verschiedener<br />
familienpolitischer Arrangements auf das durch die Gleichzeitigkeit von <strong>Familie</strong> und<br />
Beruf für Frauen entstehende Vereinbarkeitsdilemma 75 .<br />
Seit einiger Zeit werden bei <strong>der</strong> Diskussion um die Vereinbarkeit von <strong>Familie</strong> und Beruf jedoch<br />
auch zunehmend Väter in den Blick genommen. In Deutschland spiegelt sich dieser Trend sowohl<br />
in einer Reihe öffentlicher Umfragen (z. B. Pross 1978, Metz-Göckel und Müller 1985, Buchhorn<br />
2002, IfD Allensbach 2005) als auch in einer zunehmenden Anzahl jüngerer wissenschaftlicher<br />
Studien wi<strong>der</strong> (z. B. BMFSFJ 2005a, Rosenkranz, Rost und Schröther 1996, Rost und<br />
Oberndorfer 2002, Vaskovics und Rost 1999, Zulehner und Volz 1999). Im Mittelpunkt dieser Studien<br />
stand dabei zumeist die Frage, wie sich die skizzierten Wandlungsprozesse in <strong>Familie</strong> und<br />
Arbeitsmarkt auf Väter und <strong>der</strong>en ehemals dominante Rolle als „alleiniger <strong>Familie</strong>nernährer“<br />
ausgewirkt haben: Verringern junge Väter ihre Erwerbstätigkeit und übernehmen mehr Aufgaben<br />
in Haushalt und Kin<strong>der</strong>erziehung? Lässt sich eventuell sogar ein zunehmen<strong>der</strong> Trend zu<br />
„neuen“, an einer gleichmäßigen Aufteilung von Haus- und Erwerbsarbeit orientierten Vätern<br />
erkennen? Empirische Befunde für Deutschland zeichneten hier ein ambivalentes Bild, indem<br />
sie zwar einerseits einen Einstellungswandel von Vätern in Richtung liberaler Rollenvorstellungen<br />
und eine schrittweise Erosion traditioneller familialer Rollenmuster durch zunehmende<br />
Beschäftigung von Vätern mit ihren Kin<strong>der</strong>n diagnostizierten (Rosenkranz, Rost und Schröther<br />
1996, BMFSFJ 2005a: 6). An<strong>der</strong>erseits verwiesen Ergebnisse für weitere Haushaltstätigkeiten<br />
jedoch auf eine bemerkenswerte Stabilität traditioneller Rollenmuster (BMFSFJ 2005a: 6). Als<br />
ursächlich für diese konstante Ungleichheit <strong>der</strong> Arbeitsteilung in <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> wurde oft eine<br />
„konservative“ deutsche <strong>Familie</strong>npolitik angeführt, die einen vorübergehenden Erwerbsausstieg<br />
von Frauen nahe lege, damit eine klassische Aufgabenteilung för<strong>der</strong>e und zudem nur<br />
wenig Perspektiven für die Einbeziehung von Vätern in die Erziehungs- und Hausarbeit biete<br />
(z. B. Koch 2000, Beckmann 2001).<br />
Doch nicht nur auf nationaler Ebene erhalten Väter zunehmend wissenschaftliche und politische<br />
Aufmerksamkeit. Auch die Europäische Union hat sich <strong>der</strong> „För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Chancengleichheit in<br />
74 Der Autor dankt Beate Keim (Bamberg) für organisatorische und inhaltliche Unterstützung bei <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong> Expertise.<br />
75 Einen umfassenden Überblick bieten hier z. B. Daly 2000, Gornick et al. 1997, Hofäcker 2004, 2006, OECD 2001a o<strong>der</strong> Sainsbury 1999.<br />
107