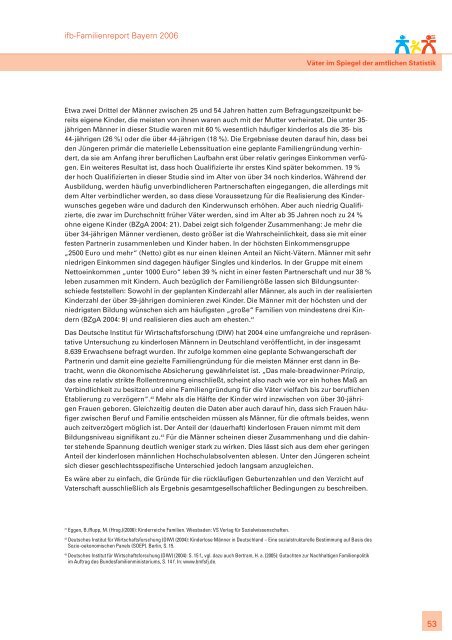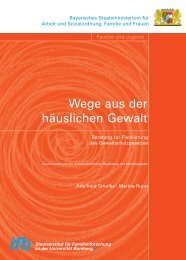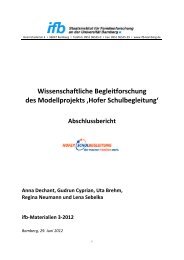ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
ifb-Familienreport Bayern 2006. Zur Lage der Familie - ifb - Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ifb</strong>-<strong><strong>Familie</strong>nreport</strong> <strong>Bayern</strong> 2006<br />
Etwa zwei Drittel <strong>der</strong> Männer zwischen 25 und 54 Jahren hatten zum Befragungszeitpunkt bereits<br />
eigene Kin<strong>der</strong>, die meisten von ihnen waren auch mit <strong>der</strong> Mutter verheiratet. Die unter 35jährigen<br />
Männer in dieser Studie waren mit 60 % wesentlich häufiger kin<strong>der</strong>los als die 35- bis<br />
44-jährigen (26 %) o<strong>der</strong> die über 44-jährigen (18 %). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei<br />
den Jüngeren primär die materielle Lebenssituation eine geplante <strong>Familie</strong>ngründung verhin<strong>der</strong>t,<br />
da sie am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn erst über relativ geringes Einkommen verfügen.<br />
Ein weiteres Resultat ist, dass hoch Qualifizierte ihr erstes Kind später bekommen. 19 %<br />
<strong>der</strong> hoch Qualifizierten in dieser Studie sind im Alter von über 34 noch kin<strong>der</strong>los. Während <strong>der</strong><br />
Ausbildung, werden häufig unverbindlicheren Partnerschaften eingegangen, die allerdings mit<br />
dem Alter verbindlicher werden, so dass diese Voraussetzung für die Realisierung des Kin<strong>der</strong>wunsches<br />
gegeben wäre und dadurch den Kin<strong>der</strong>wunsch erhöhen. Aber auch niedrig Qualifizierte,<br />
die zwar im Durchschnitt früher Väter werden, sind im Alter ab 35 Jahren noch zu 24 %<br />
ohne eigene Kin<strong>der</strong> (BZgA 2004: 21). Dabei zeigt sich folgen<strong>der</strong> Zusammenhang: Je mehr die<br />
über 34-jährigen Männer verdienen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einer<br />
festen Partnerin zusammenleben und Kin<strong>der</strong> haben. In <strong>der</strong> höchsten Einkommensgruppe<br />
„2500 Euro und mehr“ (Netto) gibt es nur einen kleinen Anteil an Nicht-Vätern. Männer mit sehr<br />
niedrigen Einkommen sind dagegen häufiger Singles und kin<strong>der</strong>los. In <strong>der</strong> Gruppe mit einem<br />
Nettoeinkommen „unter 1000 Euro“ leben 39 % nicht in einer festen Partnerschaft und nur 38 %<br />
leben zusammen mit Kin<strong>der</strong>n. Auch bezüglich <strong>der</strong> <strong>Familie</strong>ngröße lassen sich Bildungsunterschiede<br />
feststellen: Sowohl in <strong>der</strong> geplanten Kin<strong>der</strong>zahl aller Männer, als auch in <strong>der</strong> realisierten<br />
Kin<strong>der</strong>zahl <strong>der</strong> über 39-jährigen dominieren zwei Kin<strong>der</strong>. Die Männer mit <strong>der</strong> höchsten und <strong>der</strong><br />
niedrigsten Bildung wünschen sich am häufigsten „große“ <strong>Familie</strong>n von mindestens drei Kin<strong>der</strong>n<br />
(BZgA 2004: 9) und realisieren dies auch am ehesten. 41<br />
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 2004 eine umfangreiche und repräsentative<br />
Untersuchung zu kin<strong>der</strong>losen Männern in Deutschland veröffentlicht, in <strong>der</strong> insgesamt<br />
8.639 Erwachsene befragt wurden. Ihr zufolge kommen eine geplante Schwangerschaft <strong>der</strong><br />
Partnerin und damit eine gezielte <strong>Familie</strong>ngründung für die meisten Männer erst dann in Betracht,<br />
wenn die ökonomische Absicherung gewährleistet ist. „Das male-breadwinner-Prinzip,<br />
das eine relativ strikte Rollentrennung einschließt, scheint also nach wie vor ein hohes Maß an<br />
Verbindlichkeit zu besitzen und eine <strong>Familie</strong>ngründung für die Väter vielfach bis zur beruflichen<br />
Etablierung zu verzögern“. 42 Mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> wird inzwischen von über 30-jährigen<br />
Frauen geboren. Gleichzeitig deuten die Daten aber auch darauf hin, dass sich Frauen häufiger<br />
zwischen Beruf und <strong>Familie</strong> entscheiden müssen als Männer, für die oftmals beides, wenn<br />
auch zeitverzögert möglich ist. Der Anteil <strong>der</strong> (dauerhaft) kin<strong>der</strong>losen Frauen nimmt mit dem<br />
Bildungsniveau signifikant zu. 43 Für die Männer scheinen dieser Zusammenhang und die dahinter<br />
stehende Spannung deutlich weniger stark zu wirken. Dies lässt sich aus dem eher geringen<br />
Anteil <strong>der</strong> kin<strong>der</strong>losen männlichen Hochschulabsolventen ablesen. Unter den Jüngeren scheint<br />
sich dieser geschlechtsspezifische Unterschied jedoch langsam anzugleichen.<br />
Es wäre aber zu einfach, die Gründe für die rückläufigen Geburtenzahlen und den Verzicht auf<br />
Vaterschaft ausschließlich als Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Bedingungen zu beschreiben.<br />
41 Eggen, B./Rupp, M. (Hrsg.)(2006): Kin<strong>der</strong>reiche <strong>Familie</strong>n. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Väter im Spiegel <strong>der</strong> amtlichen Statistik<br />
42 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (2004): Kin<strong>der</strong>lose Männer in Deutschland – Eine sozialstrukturelle Bestimmung auf Basis des<br />
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Berlin, S. 15.<br />
43 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (2004): S. 15 f., vgl. dazu auch Bertram, H. a. (2005): Gutachten zur Nachhaltigen <strong>Familie</strong>npolitik<br />
im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, S. 14 f. In: www.bmfsfj.de.<br />
53